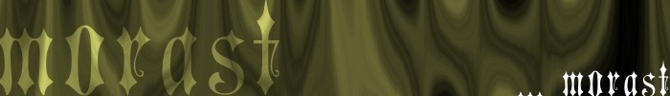Bahnbegegnungen
Nachdem die S-Bahn es wagte, nur zwei Minuten vor Abfahrt meines ICEs aus dem Bahnhof Stuttgart in selbigen einzufahren und mir somit ermöglichte, samt Gepäck in Windeseile zwei Etagen voller Treppen ersteigend längst überfälliges Konditionstraining zu absolvieren, war ich nun froh zu sitzen. Hier, auf meinem reservierten Platz im Zweite-Klasse-Abteil des ICEs nach Frankfurt.
Eine Reservierung wäre nicht nötig gewesen, stellte ich beim Umsehen fest, doch allein der Umstand, dass ich den einzigen Einzelplatz bekommen hatte und mit niemandem eine harndrangbedingte Aufsteh-Bekanntschaft eingehen brauchte, war den finanziellen Zusatzaufwand wert. Und natürlich die Aussicht. Denn auf der anderen Seite des Ganges hatte sich ein älteres Ehepaar um einen Tisch herum ausgebreitet und benahm sich beobachtungswürdig.
Der Ehemann las Bild. Dazu hatte er den größten Teil des Papiers auf dem Tisch zurechtgelegt und diesen somit völlig in Beschlag genommen. Einen weiteren Teil hielt er in den Händen. Der ihm gegenübersitzenden Ehefrau war also nicht nur der Blick auf das Gesicht ihres Gatten, sondern auch jegliche Benutzung des eigentlich für vier Personen ausgelegten Tisches verwehrt.
Bei so viel ehegattiger Ignoranz tat sie recht daran, eine Schnute zu ziehen.
Und das nicht nur einmal. Als würde sie für ein Shootoing facebookiger Duckfaces posieren, formte sich ihr Mund im Sekundentakt zu eben erwähnter Schnute, zogen sich die Lippen zur Spitzmäuligkeit zusammen, um sich gleich darauf wieder gen Normalität zu entspannen. Ein Tick, den ich zugleich störend und faszinierend fand.
Wie mochte er wohl entstanden sein?, fragte ich mich gerade, da entnahm die Schnutenfrau einer Bäckerstüte ein mit Käse belegtes Baguette. Sie richtete ein paar Wörter an ihren beschäftigt Bilder und Textfragmente betrachtenden Mann, und dieser kramte aus den Tiefen seiner Hose ein Schweizer Taschenmesser hervor.
Na klar, dachte ich, was für ein Rollenverteilungsklischee. Der Mann darf den gesamten Platz belegen und hat die Obhut über die gefährliche Waffe Taschenmesser. Die Frau hingegen kümmert sich um das Futter.
Und das tat sie. Die Schnutenfrau kreierte eine zeitunsgfreie Stelle auf dem Tisch und schnitt das Baguette erst längs und dann quer durch. Der Mann bekam zwei Stücke gereicht, blieb jedoch trotz Nahrungsaufnahme in seine Lektüre vertieft. Die Frau hingegen teilte den verbliebenen Rest noch einmal. Vielleicht war ihr Schnutenmund zu schmal.
Das Taschenmesser leistete schlechte Arbeit. Das Zerteilen sah eher aus wie eine Opferung, ein Ritual, das begangen werden musste, um die Zuggeister gnädig zu stimmen. Das würde auch erklären, warum die beiden überhaupt etwas essen musste, nur wenige Minuten von Einsteigebahnhof entfernt , so kurz nach dem Aufstehen und recht wahrscheinlichen Frühstück, das ich vermutlich sogar zum ungefähr gleichen Zeitpunkt vollzogen hatte wie diese beiden, ihr Mahl geistesabwesend hinunterschlingenden Mitfahrer.
Die Bäckerstüte wurde geräuschvoll zerknüllt, die Zeitung, die den Weg zum tischeigenen Mülleimer versperrte, kurz angehoben - und schon war jede Spur der unansehnlichen Mahlzeit beseitigt. Neue Spuren mussten her, diesmal in Form von Zitrusfruchtschalen. Die Schnutenfrau, die sich soeben um die Tischreinigung gekümmert hatte, blieb ihrem Rollenbild treu und zauberte nun eine Orange hervor, die es umständlich zuzubereiten galt.
Erst als der Mann mit geschälten, von Fäden und Kernen befreiten, einzeln zerpflückten Orangenstückchen versorgt war, gab sie Ruhe, verzog in unregelmäßigen Abständen den Mund und beseitigte die orangen Obsthinterlassenschaften. Das gesamte Abteil roch nun, was die beiden gerade verspeistet hatten - und ich fühlte ein wenig Dankbarkeit dafür, dass es kein penibel zerkleinerter Döner Kebab gewesen war.
Frankfurt nahte. Doch bevor die Stadt eine Chance hatte, ihre Großbauten neben unseren Fenstern entlanggleiten zu lassen, bevor es dem Zugbegleiter gelungen war, auf die in wenigen Minuten stattfindende dortige Ankunft hinzuweisen, war das Ehepaar aufgesprungen, angezogen und gen Tür gespurtet, wo sie dann standen und den Gang mit ihrer minutenlang ausharrenden Anwesenheit füllten.
Als der Zug schließlich in den Bahnhof einfuhr, stand auch ich auf, schnappte mir meine Tasche und verließ das Abteil. Es roch noch immer nach Orange.
morast - 15. Dez, 18:37 - Rubrik:
Bahnbegegnungen
Aus der Ferne nahen die Lichter der Bahn, und wie von selbst setze ich mich in Bewegung. Gerade, als mich darüber wundere, zu solch früher Stunde bereits zu derartigen Laufgeschwindigkeiten fähig zu sein, schließt sich die Tür hinter mir und ich setze mich auf den erstbesten freien Platz. Mit gegenüber sitzt ein Mann, Anfang Vierzig, mit Strähnchen in den zurückgekämmten Haaren. Er liest in einem Brief, mehrseitig, Recyclingpapier.
Nach einer Weile steckt er ihn die seine Tasche zurück und holt einen zweiten, identisch aussehenden hervor. Er lacht traurig, öffnet ihn und sieht ihn an. Dann mich.
"Das sind Briefe vom Jugendheim. Ich soll zahlen. Ich hatte gestern Geburtstag, und jedes Jahr zu meinem Geburtstag bekomme ich diese Briefe. Tolles Geschenk."
"Na denn. Herzlichen Glückwunsch.", antworte ich halbironisch.
"Ich bin Amerikaner.", erklärt er. "Meine Kinder sind 11. Zwillinge. Die Mutter ist gestorben, und ich darf die beiden nicht mehr sehen. Aber zahlen soll ich."
Mosaikartig bricht sein Leben aus ihm heraus. Er lernte seeen Frau in den USA kennen, schwängerte sie, heiratete sie. Seine Kinder wurden an einem Schnapszahldatum geboren.
"Das sollte doch eigentlich Glück bringen.", werfe ich ein, doch weiß, dass es das nicht tat.
Sie ließen sich scheiden, und weil die Frau Alkoholikerin war, verbrachten die Kinder viel Zeit im Heim. Vor fünf Jahren starb die Frau, vermutlich infolge ihrer Krankheit [Ihm wurde eine diesbezügliche Aussage verweigert.], und das Sorgerecht ging an das Jugendheim.
Nicht an ihn, den Vater. Weil er Amerikaner war. Ausländer.
Er hatte Besuchsrecht, durfte seine Kinder bis zu einem Tag pro Woche sehen. Die mütterlichen Großeltern hatten größere Befugnisse, doch das spielte keine Rolle. Eine Zeitlang machte er das mit, nahm Urlaubstage, fuhr Hunderte Kilometer durch Deutschland, um seine Kinder eine Stunde lang sehen zu können, kehrte dann zurück.
Er vermittelte seiner Tochter eine Brieffreundin, und ihm wurde vorgeworfen, dadurch einen Keil zwischen Heim und Kinder treiben zu wollen. Es gibt einen komplizierten Ausdruck dafür, doch ich habe ihn vergessen, sobald er ihn ausgesprochen hatte.
Nun besteht sein einziger Kontakt zu seinen Kindern in den Zahlungen, die er zu leisten hatte. Für sie ist er ein Fremder. Eine Geburtagskarte erhielt er nicht.
"Ich steige hier aus.", sagt er und geht. Verstört bleibe ich zurück, bis ich bemerkt, dass auch ich aussteigen muss, und schlüpfe rasch durch die sich schließenden Türen hinaus ins Freie.
morast - 28. Okt, 19:14 - Rubrik:
Bahnbegegnungen
Obgleich ich mich bereits der Exmatrikulation unterzog, bin ich noch immer Student. Zumindest für die Mageburger Verkehrsbetriebe, deren Semesterticket ich mit zusammen dem halbjährlichen Semesterbeitrag erwarb. Damals, als ich noch studierte. Bis Ende März ist es mir also gestattet, die öffentlichen Verkehrsmittel Magdeburgs zu nutzen, ohne eine zusätzliche Fahrkarte erwerben zu müssen. Bis Ende März darf ich also Musik hörend und lesend in geheizten Bahnen von A nach B fahren, wobei B im heutigen Fall für "Bibliothek" stand, dem Ort, von dem ich Philip Roths "Der menschliche Makel" entlieh, das ich anschließend, auf der Fahrt von B nach C, zu lesen begann, ohne mich bezüglich möglicher Kontrolleure zu sorgen.
Als ich meine Innenstädtereien hinter mich gebracht hatte und nicht nur nach C, sondern auch nach D und E gefahren war, beschloss ich, die nächstbeste Straßenbahn zu besteigen, die mich gen Heimat befördern würde. Den eisigen Temperaturen trotzend hatte ich mich tief zwischen Kleidungsschichten versteckt und mit zusätzlicher musikalischer Ohrbefüllung einen Status großflächiger Abschottung erreicht, als die Bahn sich der Haltestelle näherte, sich die Türen öffneten und dem Gefährt eine Menschenmenge entstieg.
Ein Südeuropäer hielt mir im Vorbeigehen einen Zettel entgegen. In Sekundenbruchteilen glaubte ich eine Fahrkarte auszumachen und hinter meinen Kopfhörerklängen die Frage zu erkennen, ob ich denn ein Ticket bräuchte. Als ich meiner Verwirrung entkommen war und ablehnend mit dem Kopf geschüttelt hatte, trennten uns bereits anderthalb Meter. Er zuckte mit den Schultern, und ich stieg ein.
'Meine Abschottung funktioniert nicht.', dachte ich, einen Sitzplatz findend. 'Und anscheinend sehe ich aus, als würde ich eines Fahrscheins bedürfen, als würde ich sonst schwarz fahren.' Ich prüfte im Kopf mein Äußeres, fand nichts Ungewöhnliches und beschloss, mein Buch im Rucksack zu lassen. Schließlich musste ich an der nächsten Haltestelle umsteigen.
Statt dessen beobachtete ich den unlängst installierten Fahrkartenautomaten. Beziehungsweise eine ältere Dame in Leopardenkunstpelz, die in Begriff war, dort einen Fahrschein zu erwerben.
Ich war gespannt: Würde die vermutlich nicht eben technikaffine Frau es schaffen, bis zur nächsten Haltestelle einen Fahrschein erworben zu haben? War die Automatienmenüführung unkompliziert genug, um Regulärbürgern eine einfache Nutzung zu ermöglichen?
Die Dame tippte ein paar Mal auf den Bildschirm und warf dann Geld ein. 'Das ging ja schnell!', staunte ich, dann sah ich sie zögern. Sie blickte mich an und sagte irgendetwas. Ich hörte nichts, rupfte mir die Musik aus dem Schädel.
"Kennen Sie sich hiermit aus?", fragte die Dame, und obwohl ich mit diesen Automaten im Speziellen noch nie zu tun gehabt hatte, stand ich auf.
'Verdammt!', dachte ich, 'Hätte ich doch vorhin das kostenlose Ticket angenommen. Dann könnte ich es ihr einfach in die Hand drücken.'
Der Automat meinte, dass ihm Geld fehle. 50 Cent. Bevor ich etwas sagen konnte, hatte die Dame ihren Fehler gefunden: Anstelle einer Kurzfahrkarte hatte sie eine reguläre geordert, aber nur Geld für die billigere Kurzfahrkarte eingeworfen. Ohne zu zögern korrigierte sie ihre Bestellung. Dann drehte sie sich zu mir um und lächelte.
"Danke für Ihre Hilfe."
Ich schmunzelte. "Ich habe ja nun nicht wirklich viel getan."
Als das Ticket den Automaten verließ, näherte sich die Bahn meiner Umsteigehaltestelle. 'Meine Abschottung funktioniert nicht.', dachte ich erneut, doch es war mir egal.
morast - 31. Jan, 14:27 - Rubrik:
Bahnbegegnungen
An irgendeiner Haltestelle in Magdeburg sitzend warte ich auf die Straßenbahn. Angeblich verbringt man fünf Jahre seines Lebens allein mit Warten, und ich beschließe, mein Warten nicht als Warten, sondern als Lesen zu definieren. Ich sitze also lesend an irgendeiner Haltestelle in Magdeburg, als sich ein älteres Ehepaar zu mir gesellt. Sie unterhalten sich, beziehungsweise sie imitieren eine Unterhaltung, denn in Wirklichkeit lästern sie. Ich weiß nicht, um wen es geht, doch als eine dicke Frau an uns vorbeiläuft, deren Antlitz große Ähnlichkeiten mit dem Jabba the Hutts aufweist, schweigen sie kurz, lassen sie passieren, blicken ihr hinterher und reden dann weiter. Ich höre etwas von Scheidung und denke "Schhhhh...!", denn ihr Versuch zu flüstern ist tatsächlich nur ein Versuch. Insbesondere der ältere Herr mit seiner tiefen Brummstimme scheint außerstande zu sein, dezibelarme Worte von sich zu geben, ist sich jedoch dessen nicht bewusst. Die dicke Frau verzieht das ohnehin verzogene Gesicht noch ein wenig mehr und geht wie zufällig noch ein paar Schritte weiter. Das ältere Ehepaar lässt sich nicht irritieren. Scheidung, jaja, Scheidung. Ja, die ist geschieden. Ich lese.
Zwar bin ich Freund des Straßenbahnfahrens, aber Haltestellen mag ich nicht. Ich mag nicht die stählernen Bänke, die niemals bequem und meistens zu kalt sind, mag nicht die rauchenden Mitwartenden, mag nicht, immer wieder aufzusehen, ob denn meine Bahn bereits eingetroffen ist. Diese Haltestelle ist besonders schlimm, denn ihr Blickfeld ist immens. Ohne große Schwierigkeiten kann ich eine Straßenbahn erkennen, wenn sie noch zwei Haltestellen von mir entfernt ist. Wenn ich also keine Straßenbahn sehe, heißt das, dass ich mich nicht nur ein bisschen, sondern noch eine geraume Weile zu gedulden habe. Das stört mich, und ich wehre mich gegen die Versuchung, hin und wieder die Gleise nach einer sich nähernden Bahn zu prüfen. Ich presse meine Blicke in mein Buch und versuche, die Außenwelt draußen zu lassen.
Als eine Bahn sich nähert, beginnt die Diskussion. "Die nützt uns nichts." "Nein, die biegt doch ab." "Nee, die fährt doch da lang." "Wir nehmen die nächste." "Die hier bringt uns ja gar nichts." Die beiden Rentner sind derselben Meinung, doch ihr Tonfall lässt das nicht erahnen. Gespannt erwarte ich eine Eskalation des "Streits", aber als die Bahn unbestiegen davonfährt, schweigt das Paar. Schließlich ist auch die Jabba-Frau verschwunden. Der Mann setzt eine Miene auf, die zeigt, dass er sowieso die ganze Zeit Recht gehabt hat und dennoch großmütig die Meinung seiner Frau akzeptiert. Die Frau starrt in die Richtung, aus der die nächste Bahn kommen wird.
"Ist sie das?", höre ich sie nach einer Weile fragen. "Ja. Nee.", antwortet ihr Mann und versucht, die Straßenbahn in der Ferne zu orten. Der Himmel ist grau, und die Bahn ebenso. "Die erkennt man ja gar nicht.", beschwert sich der Mann. "Normalerweise sind die hell.", fällt die Frau in denselben Meckertonfall ein. "Bei dem Wetter sieht man die überhaupt nicht.", ergänzt der Mann, und ich seufze innerlich.
Als die graue Straßenbahn an der Haltestelle einfährt, ist sie ziemlich gut sichtbar. Gut genug jedenfalls, um einzusteigen.
morast - 5. Okt, 00:23 - Rubrik:
Bahnbegegnungen
Gestern sah ich
ihn erneut. Vermutlich hätte ich ihn gar nicht bemerkt, nicht auf ihn geachtet, meinem Blick nicht von den Zeilen meines Buches abschweifen lassen, wäre hinter mir nicht eine Stimme laut geworden. "Finden Sie das etwa lustig?", fragte eine entrüstete ältere Dame, und ich gehe nicht zuweit, wenn ich ihren Tonfall als Keifen bezeichne. "Finden Sie das etwa lustig?", keifte sie also und ergänzte, die Nase in die Luft schraubend: "Ich [betonenden Pause] nämlich nicht."
Ich blickte mich um, und erfasste die Situation sofort. Draußen, vor den Scheiben unserer Straßenbahn, gab der offensichtlich geistig zurückgebliebene Junge, der mir mittlerweile vertraut und sympathisch geworden war, wieder einmal sein Ständchen. Er sang, auch wenn wir es kaum hörten, und wippte dazu mit seinem gesamten Leib vor und zurück. Und anscheinend hatte es irgendwer unweit der sich entrüstenden Dame gewagt zu kichern. Oder zu schmunzeln. Über das Gebaren eines behinderten Jungen. Oweia!
Die Angesprochene stotterte eine Entschuldigung zurecht, irgendetwas mit "Nein ... nicht lustig ... es ist nur ... wir kennen ihn ja ...". Die alte Dame, die sich so echauffiert hatte, reagierte nicht und starrte ins Leere.
"Finden Sie das etwa lustig?", hallte es in mir nach, und ich befragte mich selber: Fand
ich den anscheinend zurückgebliebenen Jungen, der Liedtexte, die er nicht verstand, in unüberhörbarer Lautsträke sang, während er rhythmisch vor und zurückwippte und sein Hund reglos danebensaß, lustig? Amüsierte ich mich, wenn meine Straßenbahn in den Magdeburger Damaschkeplatz einfuhr und ich ihn entdeckte, sah, wie er offensichtlich vergnügt Lieder zum Besten gab, die ich nicht zu erkennen vermochte, egal, ob sie nun ursprünglich deutsch- oder englischsprachig waren? Fand ich das etwa lustig?
Ich fand. Und zugleich glaubte, ich das Recht zu haben, ihn lustig zu finden. Denn ich mochte, was er tat, mochte, wie er den öden Damschkeplatz mit seiner Präsenz befüllte und mit seinen musikähnlichen Lauten beschallte, freute mich aufrichtig jedesmal, wenn ich ihn sah. Ich fand ihn lustig, aber nicht, weil ich mich über ihn lustig machte, nicht, weil ich darüber lächelte, wie dumm dieser Kerl doch sei, wie wenig er von seiner Außenwelt zu begreifen schien.
Die alte Dame hat Unrecht, fand ich. Denn weder ich noch viele andere in der Straßenbahn Sitzende wären imstande gewesen, ihr Lächeln zu unterdrücken, und es gehörte schon ein gehöriges Maß an Bitterkeit und Ignoranz dazu, die primitive Schönheit zu verkennen, die in der Sangesdarbietung lag. Jemand sang, nicht gut, aber offensichtlich zu seiner eigenen Zufriedenheit. Und niemand störte sich daran.
Hinzu kam, dass nicht nur es Freude war, die aus den Augen der Beschauer sproß. Zugleich entdeckte ich Ver- und Bewunderung, Sorge und Mitgefühl. Ich konnte die Gedanken hören, die sich um das sicherlich sonderbare Schicksal des Jungen kreisten, konnte die Fragen vernehmen, die dessen Präsenz verursachte. Und doch lächelten wir. "Finden Sie das etwa lustig?", schallte es durch meinen Schädel, und ich nickte. Ja, trotz allem fand ich den Jungen lustig.
Es gibt eine Grenze, dachte ich. An irgendeinem Punkt hört die Freude über das sonderbare Verhalten des Jungen auf und verwandelt sich in Hohn. Ab irgendeinem Punkt ist das Lustig-Finden tatsächlich falsch. Diese Grenze nicht zu überschreiten, ist schwer, vielleicht unmöglich. Allein durch mein permanentes Starren wertete ich den Wippenden ab, degradierte ihn zu einem Faszinosum, das es wert war, begafft zu werden. Doch andererseits ist der Versuch, das Starren zu verbieten, zu verhindern, gleichsam ungut, enthielte er doch ein Verleugnen der eigenen Neugier und die Ignoranz des Offensichtlichen.
Tatsächlich fiele es mir schwer, nicht zu schmunzeln angesichts des damaschkeplatzigen Anblicks. Und ich glaube, solange dieses Schmunzeln auf Sympathie, auf aufrichtiger Freude, beruht, solange es sorgende Hintergedanken mit sich trägt, solange es nicht in Häme und abwertendes Gebahren mündet, solange ich in dem Darbieter keine Witzfigur, kein niederes Wesen, sehe, solange darf ich es auch beibehalten.
Die kraftlose Antwort der mit Vorwürfen Bestückten war ohne Wert. Doch die Vorwürfe der entrüsteten Dame umso mehr. Bloß weil jemand Mitleid erregt, muss ich nicht in Trübsinn schwelgen. Denn nicht alles Traurige ist frei von Witz, und nicht jeder Witz frei von Trauer.
morast - 18. Sep, 15:14 - Rubrik:
Bahnbegegnungen
Während ich an der Haltestelle stand und auf meine Bahn wartete, kam ein älterer Man mir kurzem, weißem Haar und fragendem Gesichtsausdruck langsamen Schrittes herbeigelaufen. In unmittelbarer Nähe des Haltestellenhäuschens blieb er stehen und blickte suchend auf den Boden. Noch bevor ich mich fragen konnte, was er verloren hatte, bückte er sich und hob eine Zigarettenkippe auf.
Nun finde ich Zigarettenkosnum an sich schon verhältnismäßig ungut, doch der Zwang, der einen dazu treibt, kümmerliche Reste ehemaliger Rauchwaren vom Boden aufzuklauben und in der eigenen Tasche verschwinden zu lassen, betrübt mich. Ich fragte mich, was er später mit dem Stummel machen würde, aber ihn noch einmal anzuzuünden versuchen würde, um ihm ein oder zwei Züge zu entlocken, oder ob er nur den Tabak herausbröseln, ihn sammeln und zu neuem Glutgut vereinigen würde. Doch dafür bräuchte er Papers, die wiederum Geld kosteten.
Die Geschwindigkeit, mit der er den Stummel in seiner Jackentasche verschwinden ließ, obgleich er ansonsten recht ungelenk wirkte, ließ mich zweierlei vermuten: Er praktizierte die Stummelsuche regelmäßig. Und: Er schämte sich ihrer.
Der Mann ging weiter und zeigte dabei einen erstaunlichen Laufstil: Alle paar Schritte blieb er stehen, hielt inne und schaute auf den Boden. Zwei Schritte. Stehenbleiben. Gucken. Weitergehen. Vier Schritte. Stehenbleiben. Auf den Boden schauen. Weitergehen.
Ich war versucht, ihm einen Euro zuzustecken oder mehr, damit er sich echte Zigaretten kaufen könnte, doch zugleich weigerte ich mich, diese üble Angewohnheit zu unterstützen. Glücklicherweise – für mich, für ihn eher unglücklicherweise – entdeckte er keinen weiteren brauchbaren Stummel und lief weiter, fort von der Haltestelle, fort aus meinem Blickfeld, sein Laufmuster beibehaltend: Ein paar Schritte. Stehenbleiben. Gucken. Weiterlaufen.
Am nächsten Tag sah ich ihn wieder. Ich befand mich auf dem Weg zur Haltestelle, als er mir auffiel. Er hatte seine Jogginghose in die Socken gestopft. Zumindest sah es so aus, und ich fragte mich, warum mir das am Vortag nicht aufgefallen war.
Der Mann ging vor mir, und ich drosselte die Geschwindigkeit, um seinen Laufstil zu beobachten. Und tatsächlich: Ein paar Schritte. Innehalten. Weiterlaufen. Immer wieder.
Heute verzichtete er auf den suchenden Blick auf den Boden, doch auf dafür gab es eine Erklärung: Er rauchte.
In seinem Mund steckte eine fürchterlich stinkende Zigarillo, die er immer, wenn er gerade lief, in die Hand nahm, und an der er immer, wenn er stand, zog. Eigentlich wirkte es eher so, als würde er bewusst alle paar Schritte innehalten, um genüßlich an der Zigarillo zu ziehen. Rauchen. Weiterlaufen. Stehenbleiben. Rauchen.
Verdutzt überholte ich ihn. Hatte sein Rauchverhalten seinen Gehstil geprägt?, fragte ich mich. Konnte es sein, dass er sich so sehr an das Innehalten gewöhnt hatte, dass er gar nicht mehr imstande war, anders zu laufen? Dass er, selbst wenn er nicht an einem Glimmstengel zog, Pausen machte und diese nutzte, um auf dem Boden nach weiterem Rauchzeug zu schauen?
Als meine Bahn kam, lächelte ich kurz: Das stetige Innehalten zum Inhalieren oder Stummelsuchen lieferte eine völlig neue Definition des Wortes "Raucherpause"...
morast - 22. Jul, 09:46 - Rubrik:
Bahnbegegnungen
Der Magdeburger Damaschkeplatz ist der Inbegriff von Hässlichkeit. Und obwohl sich hier der Nachtverkehr zur Weiterfahrt sammelt und Umsteigenden die Möglichkeit gibt, sich in alle Richtungen Magdeburgs transportieren zu lassen, vermeide ich es, hier zu warten. Verkachelte Betonklotzhäuschen von häßlich graubrauner Farbe, die vermutlich noch nicht einmal in den 70ern hübsch ausgesehen hatten, erinnern nur zu deutlich daran, was für einen abartigen Geschmack Städtebauer zuweilen gehabt haben mussten.
Üblicherweise passiere ich den Damaschkeplatz in einer Bahn opder einem Bus sitzend, und selbst wenn der Nachtverkehr minutenlang auf Neuankömmlinge wartend an Ort und Stelle steht, bin selten ich es, der zusteigt. Nein, ich bin der, von innen nach außen schaut und interessiert die Leute betrachtet, die sich dort auf den Bahnsteigen und innheralb der anderen Gefährte tummeln.
In den letzten Tagen entdeckte ich immer wieder einen jungen Mann, vielleicht zwanzig, mit kurzem, dunklem Haar, modischer, aber unspektakulärer Kleidung und einem Schäferhund an der Leine. Der Schäferhund wirkte freundlich, und ihm schien es keineswegs etwas auszumachen, dass sein Herrchen immer wieder vor- und zurück wippte, wieder und wieder, einem Metronom gleich.
Ich wunderte mich ein wenig, doch bin ich bisher genug behinderten Menschen begegnet, um das Wundern nicht lange beibehalten zu können. Als sich Busse und Bahnen in Bewegung setzten, hatte ich den jungen Mann zumeist schon wieder vergessen.
Heute jedoch wartete ich am Damaschkeplatz. Der Optimist in mir hatte mich davon überzeugen können, dass ich möglicherweise eine frühere Bahn erreichen könne, wenn ich nur alsbald zum Damaschkeplatz käme - und irrte sich. Ich war allein auf dem Bahnsteig, und obwohl meine Bahn erst in zehn Minuten eintreffen würde, war ich nicht gewillt, mich laufenderweise nach Hause zu begeben. Schließlich wartete in meinem Rucksack ein Buch darauf, gelesen zu werden.
Ich setzte mich, ignorierte den aus dem Fußgängertunnel zeitweise hervorquellenden Urindunst, ignorierte den Boden unter meinen Schuihen, der angefüllt war mit Zigarettenkippen und nicht näher zu definierendem Ehemaligem, ignorierte die Un-Architektur um mich herum - und begann zu lesen. Dann vernahm ich Gesang.
Keineswegs waren es Engelchöre oder menschliches Äquivalent, das da an mein Ohr drang, auch Worte waren nicht vernehmbar - und dennoch handelte es sich um Gesang. Ich blickte auf, und mir gegenüber, auf der anderen Gleisseite stand der junge Mann und wippte hin und her. Nein, vor und zurück wippte er, und zwar in konstant gleicher Geschwindigkeit und im Takt zu den Lauten, die aus seinem Mund drangen.
Denn Laute waren es, die er von sich gab, nicht viel mehr. Es war, als hörte man Timmy aus Southpark zu, wie er versuchte zu singen. Und nicht nur das: Der erste Eindruck hatte mir vorgegaukelt, Englisch zu vernehmen, doch das, was der junge Mann ertönen ließ, waren Silben, die eher Englisch imitierten als es zu sein. Es war, als würde er ein Lied nachsingen, dessen Text er nicht verstanden hatte.
Sein Gesang hätte niemand als schön oder ergreifend bezeichnen können, doch war er auch kein verqueres Musikgebilde, das einem zerrütteten Geist entsprungen war. Nein, der junge Mann traf Töne, hielt den Rhythmus - und kannte offensichtlich das gesamte Lied in- und auswendig - wenn man von seiner kleinen Textschwäche absah. Minutenlang saß ich wie gebannt da, außerstande, mich auf mein Buch zu konzentrierten, gebannt von dem, was auf der anderen Seite der Gleise geboten wurde.
Was ich hörte, war moderne Rockmusik, und ich bemühte mich verzweifelt zu erkennen, um welche Band es sich handelte. Doch abgesehen von einem Wort, das "closer" heißen konnte, war kein Text auszumachen - und somit jede Chance auf potentielle Nachrecherche vertan. Also lauschte ich nur und versuchte, einen Blick auf das rechte Ohr des Jungen zu werfen. Denn nur das linke war mir zugewandt - es war leer, und ich hätte gerne gewusst, ob sich im rechten ein klitzekleiner Kopfhörer verbarg.
Mit welcher Unermüdlichkeit er vor sich hin sang, beeindruckte mich. Er musste dieses Lied wirklich lieben, wenn er es auf diese Art und Weise auswendig kannte. Als es endete, begann ein weiteres, ebenso detailreich wiedergegeben, ebenso unverständlich wie das erste. Ich war fasziniert.
Meine Faszination war jedoch noch steigerbar: Denn irgendwann bemerkte ich ein hintergründiges Taktgeräusch. Es klang, als trete man mit feuchtem Schuh kräftig auf und das Wasser quetschte sich aus dem zusammengepressten Material. Oder als fegte man mit einem Handfeger über groben Asphalt. Dies war das Metrum, und es deckte sich mit der Wippbewegung des Jungen, die ihn abwechselnd den linken und den rechten Fuß, beziegungsweise, da er in Schrittstellung stand, den vorderen und hinteren Fuß heben ließ. Und es passte zu seinem Gesang, selbst als sich dieser - bewusst - neben dem Takt bewegte.
Ich begriff es nicht. Irgendwo musste das Geräusch doch seine Ursache haben. Es seinen Schuhen zuzuordnen, wäre logisch gewesen, doch niemals wäre sein Schuhwerk, so trocken und unversehrt es war, zu solchen Geräuschen fähig gewesen. Der Taktklang musste aus seinem Mund kommen.
Aber auch das war kaum möglich, sang er doch stetig und kontinuierlich, gepresst und mit Timmy-artig genutzter Stimme, und ich an seiner Stelle hätte ein zusätzliches Taktgeräusch nicht gleichzeitig hervorbringen können. Aber vielleicht er. Vielleicht hatte er, ohne es bewusst wahrzunehmen, eine Möglichkeit gefunden, seinem Mund zugleich Perkussion und Gesang zu entlocken.
Ich horchte, beobachtete ihn. Ich schämte mich nicht, ihn anzustarren, denn er schämte sich auch nicht, auf öffentlichem Platz vor wachsendem Warte-Publikum lautstark englischige Rockmusik zu intonieren. Besonders gewissenhaft achtete ich auf Pausen. An irgendeiner Stelle musste er doch stillstehen, innehalten, den Takt ruhen lassen, oder mit dem Wippen aufhören. Doch das geschah nicht. Drei komplette Lieder, von Anfang bis Ende, zumindest soweit ich das beurteilen konnte, vernahm ich, und nicht einmal hielt er inne und ließ mich erkennen, woher das Taktgeräusch stammte, das mich so sehr rätseln ließ. Und auch die Band erkannte ich nicht, wenngleich ich feststellte, die Musik für eingängig und hörbar zu befinden.
Sein Schäferhund war dieses Gebaren offensichtlich gewohnt. Im Takt schwang seine Leine auf und ab, doch er blieb stoisch sitzen, mit gespitzen Ohren seine Umgebung wahrnehmend, als wäre es das Normalste der Welt, dass jemand auf einem Umsteigebahnhof für öffentlichen Personenahverkehr lautstark Lieder trällerte.
Dann kam meine Bahn, und alsbald füllte sich der gesamte Damaschkeplatz mit Gefährten, mit Aus- und Umsteigenden. Ich behielt den jungen Mann im Auge, als ich mir einen Sitzplatz suchte, betrachtete ihn durch drei Glasscheiben hindurch - doch von seinem Gesang vernahm ich nichts mehr. Er wippte weiter vor sich hin, zog die Aufmerksamkeit verschiedener Passagiere auf sich, doch stieg nirgendwo ein. Er hatte kein Ziel, nur seine Musik, die er unverdrossen erklingen ließ.
Ich freute mich. Keine Zeile meines Buches hatte ich gelesen; die Faszination war stärker gewesen.
Als meine Bahn zur Fahrt ansetzte, trat eine ältere Frau auf den jungen Mann zu, kramte in ihrer geblümten Tasche und holte Süßigkeiten hervor. Sie unterhielt sich mit ihm, und lächelnd nahm ich wahr, wie er selbst, als er ihr antwortete, nicht aufhörte zu wippen.
[Im Hintergrund: Empyrium - "A Wintersunset..."]
morast - 18. Jul, 00:05 - Rubrik:
Bahnbegegnungen
Ich mag es, mit der Bahn zu fahren. Das ist erstaunlich, denn ich bin mir durchaus dessen bewusst, dass ich das bequeme Reisen mit der Eisenbahn romantisiere. Will ich wirklich produktiv sein, suche ich mir einen anderen Ort als die Bahn aus. Zum Entspannen dient eine Fahrt, egal ob kurz oder lang, auch nicht; zuviel gibt es, was ablenkt, stört oder interessiert. Und die Bequemlichkeit der Sitze vermag auch nicht, zum Verweilen einzuladen. Und doch: Ich mag es, mit der Bahn zu fahren, mag es, in unnatürlicher Haltung zukünftige Comics zu skizzieren, mag es, von Schaffnern und Kaffebringern aus meiner Lektüre gerissen zu werden, mag es, wenn mein Sitznachbar versucht, sich gleichzeitig auszubreiten und zusammenzufalten.
Und ich mag es, mein Fahrrad mitzunehmen. Insbesondere bei Kurzstrecken und insbesondere in Sachsen-Anhalt, wo die Fahrradmitnahme in Regionalzügen kostenfrei ist, bietet es sich an, das eigene Rad als Begleitung zu erwählen, um im Stadtverkehr nicht zusätzlich für öffentliche Verkehrsmittel zahlen zu müssen und zugleich äußerst flexibel zu sein. Unglücklicherweise bin ich selten der einzige, der diesen Mobiltätsvorteil nutzt und muss häufig sehen, wie ich mein Fahrrad verstaue, ohne gleichzeitig den gesamten Gang zu blockieren.
Denn obwohl die Bahn freundlicherweise besondere Zugteile für Radreisende reserviert, ist die Anzahl dort positionierbarer Fahrräder nicht nur begrenzt, sondern schlichtweg lächerlich. Die Regionalbahn, die ich unlängst benutzte, fühlte sich bespielsweise bereits mit vier Fahrrädern überfordert. Alles, was mehr war, stand im Weg und barg außerdem die Gefahr, jederzeit umfallen zu können. Denn die früher üblichen Gurte, mit denen auf simpelste Weise Räder vertäut und standsicher gemacht werden konnten, existieren nicht mehr, nur noch metallene Ösen, an die man sein Rad anschließen kann - so man denn das Fahrrad besitzt, das unmittelbar an der Wand lehnt.
Die Schaffnerin war wenig erfreut, als sie das Radkonstrukt sah. "Dass die Leute aber auch ihre Räder nicht ordentlich hinstellen können...!", grummelte sie, obwohl die "Leute" allesamt mithören konnten. Und tatsächlich war es weniger die Schuld der "Leute", sondern vorrangig die der "anderen Leute", nämlich jener, die beschlossen hatten, dass sich die besten Sitzplätze dort befänden, wo für Fahrräder Platz gewesen wäre. So verhinderte beispielsweise eine äußerst beleibte Frau durch ihre Sitzhockerei, dass ich mein Rad optimal deponieren konnte - und ließ sich auch nicht davon stören, dass nur wenige Millimeter neben ihrem Leib zahlreiche Gummi- und Metallverflechtungen aufragten.
Ich sagte nichts, denn ich hielt sie nicht für dumm genug, ihre Albernheit nicht zu bemerken, ignorierte die Schaffnerin und setzte mich so, dass ich mein Rad im Blick hatte und jederzeit aufspringen konnte, um es am Umfallen zu hindern, wieder aufzuheben oder beiseite zu schaffen. Mir gegenüber saß ein Polizist, und ich war erstaunt, dass ich diesmal nicht das übliche Schuldgefühl verspürte, das mich sonst befällt, wenn ich der Ordnungsmacht gegenüberstehe. Ich habe nichts getan, und doch reicht die Anwesenheit eines Polizisten normalerweise aus, um mich zu fragen, ob ich nicht doch irgendwelche Übel verbrochen hatte.
Dieses Exemplar jedoch war vollkommen sympathisch. Er besaß weder den Klischeeschnauzbart noch den Klischeebierbauch, sondern ein freundliches und offenes Gesicht und eine häßliche Uniform. Die Idee, dass senfgelb auch nur ansatzweise sympathisch wirken könnte, erwies sich umso absurder, je länger ich auf das Hemd des Polizisten starrte. Die ganze Zeit über konnte ich mich des Gefühls nicht erwehren, mich in der Rückblende eines Films zu befinden, in der ausschließlich ausgeblichene Farben existierten. Und außerdem: Was sollte diese alberne Doppelnaht auf der Hemdhinterseite? Hatte sie eine Funktion? So wie die Hemdtasche, in der praktischerweise ein winziges, abgetrenntes Fach für Kugelschreiber existierte?
Ich besitze nur wenig Modekenntnis, doch konnte den Anblick des Hemdes kaum ertragen. Es war, als wäre ich in eine fremde Zeit katapultiert worden. 'Die Ärmel sind zu lang.', dachte ich noch, bevor mein Blick sich in den Sternen auf der Polizistenschulter verfing. Drei Sterne, und ich hatte keine Ahnung, ob das viel war oder was sie bedeuteten. Noch während ich grübelte, bemerkte ich die Mütze. Der Polizist hatte sie die ganze Zeit in der Hand gehalten, doch nun, da er in Begriff war auszusteigen, setzte er sie auf. Ach herrje! Kein Wunder, dass ich, wenn ich Polizisten zeichnete, immer an den Mützen verzweifelte. Diesen Dingern fehlte jede Ästhetik. Mehr noch: Sie waren imstande, die Häßlichkeit des Hemdes zu überbieten!
Der Zug war vollbesetzt. Daher konnte ich durchaus die dicke Dame verstehen, die sich krampfhaft an ihren, von Fahrrädern eingekeilten Sitzplatz klammerte. Und dennoch: Hier und da fanden sich jene, die selbst bei voller Zugbesetzung beschließen, sich unbedingt über zwei Plätze querlegen zu müssen. Mit einer höflichen Nachfrage hätte sicherlich jeder, auch die Stehenden, ein Plätzchen ergattern können. Doch im Pulk sind Menschen doof, und so wunderte es mich auch nicht, dass ausgerechnet dann, als der Zug seine Maximalbefüllung erreicht hatte, jemand beschloss, einen Bekannten anzurufen.
"Ich sitze gerade im Zug.", war dann auch der inhaltsintensivste Satz des Telefonats, dessen diesseitiger Anteil von gefühlten dreihundert Personen vernommen werden konnte. 'Warum sucht man sich ausgerechnet den am dichtesten gepackten Ort aus, um private Informationen zu verkünden?, fragte ich mich, doch wurde rasch wieder abgelenkt. Zwei Sitzplätze weiter löste eine junge Frau großformatiges Sudoku, und interessiert beteiligte ich mich an ihren Bemühungen, die leeren Kästchen zu füllen. "Da muss 'ne 4 rein!", wollte ich hinüberrufen, doch schwieg und starrte aus dem Fenster.
'Wie schnell fahren wir eigentlich?', überlegte ich. Offensichtlich nicht schnell genug, denn eine winzige Spinne hatte keine Mühe, auch bei höheren Geschwindigkeiten an der Außenseite der Fensterscheibe zu kleben. 'Nicht schlecht.', dachte ich bewundernd und erschrak, als es plötzlich schepperte. Ein Fahrrad war umgefallen - ausgerechnet das der lautstark Telefonierenden.
'Ich mag es, mit der Bahn zu fahren.', dachte ich und grinste.
morast - 9. Jul, 17:20 - Rubrik:
Bahnbegegnungen
Alle Zeichen waren positiv; die Zugfahrt schien, obgleich noch einmal ansatzweise begonnen, zu einer angenehmen zu werden. Ich hatte meinen Fünf-Euro-
Gutschein bereits eingelöst und längst eine Fahrkarte erworben. Zudem hatte ich den Bahnhof zu einem Zeitpunkt betreten, der mich den nächsten Zug knapp aber problemlos erreichen ließ - im Gegensatz zum üblichen Verfahren, bei dem ich ausgerechnet dann das Bahnhofsgebäude betrete, wenn mein gewünschter Zug gerade die Gleise verlässt.
Mein Zug stand bereits fast eine halbe Stunde auf dem Bahnsteig, hatte also genug Zeit gehabt, sich mit Menschengruppen zu füllen und durch magische Verteilung dafür zu sorgen, dass ausgerechnet denjenigen Personen, neben denen noch vereinzelte Plätze zu finden waren, jede Fähigkeit verlorenging, ansatzweise sympathisch zu wirken. Das jedenfalls wäre die übliche Prozedur gewesen, und mich hätte es nicht gewundert, neben einem übergewichtigen Fastfoodabsorbierer und dessen allzu schwatzhafter Lebensabschnittgefährtin Platz nehmen oder mit einer Überzahl an Fahrrädern um den letzten Sitz kämpfen zu müssen. Angenehmerweise jedoch waren genug Plätze frei, und ich bekam nicht nur eine eine Vierergruppe zugestanden, auf der ich mich und mein Gepäck ausbreitete, sondern saß auch noch am Fenster in Fahrtrichtung.
Glücklich lehnte ich mich zurück und genoss zugleich das gute Gefühl zu wissen, in den nächsten siebzig Minuten Zugfahrt nicht in die Verlegenheit kommen würde, die üblicherweise zugewiderte Zugtoilette besuchen zu müssen. Ich konnte einfach hier sitzen, ein paar mitgebrachte Süßigkeiten verzehren, aus dem Fenster sehen und die Fahrt genießen...
Doch halt! Im letzten Moment stiegen weitere Passagiere zu. Vier Stück. Mutter, Vater, zwei Söhne. Neben meinem befand sich noch ein weiterer Vierer, vollkommen unbesetzt, und ich ertappte mich, wie ich wiederholt flüsterte: Nicht hier. Nicht hier. Nicht hier. Natürlich setzten sie sich. Der ältere der beiden Söhne hörte nicht auf, wegen irgendwelcher Kleinigkeiten zu maulen, der andere zog sogleich die Sandalen aus und platzierte seine nackten Füße provozierend unweit seines Bruders. Die Eltern jedoch nahmen Abstand. Nicht, indem sie ihre Kinder ignorierten, sondern indem sie sich zu mir setzten.
Ich nahm also meinen Rucksack von der Bank, hängt meine Jacke ordnungsgemäß an einen Haken und verzichtete darauf, meine Beine langzumachen. Als der ältere Sohn erneut zu maulen begann, blickte mich die Mutter an, als wüsste ich Bescheid, wie Söhne manchmal sind. Lass mich da raus, wollte ich denken, doch die Frau war zu sympathisch. Sicherlich, sie hätte etwas mehr essen können und ihre Kleidung erweckte den Eindruck, eine vehemente Ökotussi vor mir zu haben, doch ihr Lächeln war nett, und beeindruckenderweise schaffte sie es, mittels weniger Worte ihren Sohn zu besänftigen und gleichzeitig zu tadeln.
Der Vater wirkte zwar, als hätte wüßte er seine Kleidungsgrößen nicht und als würde ein böses Wort ihn zu Tränen rühren, doch zugleich gelang es mir nicht, ihn unsympathisch zu finden. Dann halt nicht.
Ich holte mein Buch aus dem Rucksack und verkroch mich dahinter. Aber als mich nach wenigen Minuten umblickte, war eine unglaubliche Wandlung vorgegangen. Die gesamte Familie schwieg - und las. Jeder einzelne hielt sich ein Buch vor die Nase und las. Einfach so. Jedes Gespräch war unterbrochen, jeden Nörgelei beseite gelegt. Mami las etwas von Coelho, "Der Dämon und das Fräulein Prym", und wunderte sich ihrem Mann gegenüber, dass sie das nicht bereits gelesen habe. Er wiederum las "Bloody Mary" von Tom Sharpe und schmunzelte hin und wieder bei einigen Passagen. Was die Söhne lasen, konnte ich nicht genau erkennen, doch sah ich, dass sich der ältere irgendetwas aus dem Diogenees-Verlag vor die Augen hielt, während der jüngere ein dickes Hardcover-Fantasy-Werk schmökerte, von dem es anscheinend auch noch mehrere Teile gab.
Ich war verblüfft, und ja, ich schmämte mich sogar, weil das Buch, das ich selber in den Händen hielt, A. Lee Martinez "Eine Hexe mit Geschmack", anspruchloser Fantasykram war und ich plötzlich das Gefühl bekam, minderwertigen Schund zu lesen - verglichen mit der Familie. Natürlich war mein Buch nicht vollkommen minderwertig, doch ein Blick auf das - wie so
oft - nicht mit dem Buchinhalt in Zusammenhang stehende Cover hätte dergleichen vermuten lassen können.
So saßen wir also im Zug nach Magdeburg, fünf Leute, die allesamt schwiegen und lasen. Ich grinste in mich hinein. Nicht nur, weil ich plötzlich die Eltern respektierte, die es geschafft hatten, ihre Kinder dazu zu bringen, freiwillig zu lesen, sondern auch, weil die Zugfahrt sich anscheinend doch als problemlos und entspannt erwies. Dass ich mir etwas mehr Beinfreiheit gewünscht hätte, war dann auch nicht mehr so wichtig.
Die Fahrkartenkontrolleurin war freundlich und hatte Geduld mit mir, als ich den halben Rucksack umkrempeln musste, um an meine Bahncard zu gelangen. Und als dann der jüngste Sohn triumphierend "Ich bin durch!" ausrief und sein Buch wie zum Beweis in die Luft hielt, dachte ich, dass irgendjemand die übliche Welt der Zugfahrt ausgetauscht und durch eine angenehmere Variante ersetzt haben musste.
Ich las weiter, und der jüngste Sohn fand eine weitere Beschäftigung: Er hörte Musik. Leise genug, um mich keinen Ton vernehmen zu lassen. Lang genug, um niemanden zu stören. Laut genug, um auf die Fragen seines Bruders nicht zu reagieren. Denn dieser wollte sich anders hinsetzen und die Fußproblematik vom Reisebeginn war noch nicht ausgestanden. Doch bevor die Sache eskalieren konnte, hatte sich der Vater erhoben. "Wollt ihr was essen?", fragte er, verteilte selbstbelegte Brote und Brötchen und glättete in Sekundenschnelle die Wogen.
Spätestens jetzt müsste ich angwidert das Gesicht verziehen, dachte ich, darauf wartend, dass ekelhafter Leberwurstgestank oder ähnliches zu mir herüber dringen würde. Doch nichts dergleichen geschah. Ich schüttelte ungläubig mit dem Kopf.
Ich fischte das letzte Schokoding aus der Packung, gerade als der Zug in Magdeburg einfuhr. Perfekt, dachte ich vergnügt, und stopfte mein Buch in den Rucksack. Die Familie stieg aus. Ohne großes Trara, ohne Maulerei oder Gedränge. Sekunden später war auch ich auf dem Bahnsteig und pröblemlos schlängelte ich mich in Richtung Ausgang.
Draußen schien die Sonne. Was ist nur los?, fragte ich mich. Will man mir denn allen Grund nehmen zu meckern? Ist dies gar der erste Schritt zu einer perfekten Welt? Dann sah ich die Straßenbahn. Wäre ich gerannt, hätte ich sie trotzdem verpasst. Immer das Gleiche!, echauffierte ich mich und ging zu Fuß nach Hause.
morast - 16. Jun, 15:42 - Rubrik:
Bahnbegegnungen
Es war fast alles geklärt. Nach ein paar Umständen und Tagen hatte ich meine EC-Karte zurückerhalten und schließlich sogar entsperren können. Doch obwohl ich hätte zufrieden sein können, wollte ich unbedingt noch einen Schritt weitergehen: Die Deutsche Bahn sollte bluten!
Naja, nicht ganz. Eigentlich war es mein Wunsch, die knapp zehn Euro, die ich aufgrund des defekten Fahrkartenautomaten in Richtung Automatenstörstelle vertelefoniert hatte, zurückerstattet zu bekommen. Als ich jedoch während der EC-Karten-Aushändigung an einem Schalter im Magdeburger Hauptbahnhof diesbezüglich nachgefragte, konnte man mir nicht weiterhelfen. Mir wurde nur eine Visitenkarte gereicht, auf der eine Telefonnummer verzeichnet war, an die man Beschwerden richten konnte - für 14 Cent pro Minute.
Ihr seid wohl bescheuert!, dachte ich. Ich möchte Telefonkosten erstattet bekommen und soll dafür Telefonkosten verursachen? Auf keinen Fall! Und so nutzte ich ein auf der Bahn-Seite aufgeführtes Kontaktformular, in das ich meine Daten und Wünsche eintrug. Eine erste Bestätigungsmail wurde generiert. Hurra.
Als nach drei Tagen nichts geschehen war, seufzte ich kurz und füllte das Formular ein weiteres Mal aus. Die zweite Bestätigungsmail erreichte mich. Und das war alles. Am Tag darauf wiederholte ich das Spiel und erhielt, abgesehen von der dritten Bestätigungsmail, keine Reaktion.
Doch als ich heimkehrte, wartete im Briefkasten bereits ein Schreiben auf mich. Von der Deutschen Bahn.
Sehr geehrter Herr morast,
vielen Dank für Ihre E-Mail vom 5. Juni.
Wir arbeiten zwar durch regelmäßige Wartung an der Zuverlässigkeit der Automaten, aber so ein Automat fällt schon mal aus.
Bitte entschuldigen Sie, was Sie erlebt haben.
Eine Erstattung der Telefonkosten ist leider nicht möglich.
Aus Kulanz erhalten Sie aber einen Gutschein im Wert von 5,00 EUR. ...
Es war offensichtlich, dass der Text zur nach dem Baukastenprinzip zusammengebastelt wurde. Eine Erklärung, warum Telefonkostenerstattung nicht möglich sei, enthielt er auch nicht. Dafür aber den Hinweis auf eine Telefonnummer, die ich anrufen könne, falls ich noch Fragen habe. Für 14 Cent pro Minute.
Die Unterschrift erwies sich als doppelt interessant. Zum einen war sie natürlich nicht echt, sondern nur ein eingefügtes jpg niederer Qualität. Die Farbe hinter dem Schriftzug war eindeutig nicht weiß. Zum anderen amüsierte sie mich. Schließlich hätte ich nicht gedacht, dass es tatsächlich Menschen gibt, die so heißen, wie diejenigen, die Bart in einer uralten Simpsons-Folge bei einem Telefonstreich mit Moe ausrufen lässt: "Ist hier jemand, der Reinsch heißt?"
Und natürlich freute ich mich. Sicherlich, mit fünf Euro kam man nicht weit, doch freute ich mich über meinen kleinen Erfolg, darüber, dass die ganze Sache nun ausgestanden war und sogar ein positives Ende bekam.
Die ganze Geschichte: Teil I,
Teil II,
Teil III,
Teil IV morast - 12. Jun, 10:15 - Rubrik:
Bahnbegegnungen