Die Spinne am Fenster
Ich mag es, mit der Bahn zu fahren. Das ist erstaunlich, denn ich bin mir durchaus dessen bewusst, dass ich das bequeme Reisen mit der Eisenbahn romantisiere. Will ich wirklich produktiv sein, suche ich mir einen anderen Ort als die Bahn aus. Zum Entspannen dient eine Fahrt, egal ob kurz oder lang, auch nicht; zuviel gibt es, was ablenkt, stört oder interessiert. Und die Bequemlichkeit der Sitze vermag auch nicht, zum Verweilen einzuladen. Und doch: Ich mag es, mit der Bahn zu fahren, mag es, in unnatürlicher Haltung zukünftige Comics zu skizzieren, mag es, von Schaffnern und Kaffebringern aus meiner Lektüre gerissen zu werden, mag es, wenn mein Sitznachbar versucht, sich gleichzeitig auszubreiten und zusammenzufalten.
Und ich mag es, mein Fahrrad mitzunehmen. Insbesondere bei Kurzstrecken und insbesondere in Sachsen-Anhalt, wo die Fahrradmitnahme in Regionalzügen kostenfrei ist, bietet es sich an, das eigene Rad als Begleitung zu erwählen, um im Stadtverkehr nicht zusätzlich für öffentliche Verkehrsmittel zahlen zu müssen und zugleich äußerst flexibel zu sein. Unglücklicherweise bin ich selten der einzige, der diesen Mobiltätsvorteil nutzt und muss häufig sehen, wie ich mein Fahrrad verstaue, ohne gleichzeitig den gesamten Gang zu blockieren.
Denn obwohl die Bahn freundlicherweise besondere Zugteile für Radreisende reserviert, ist die Anzahl dort positionierbarer Fahrräder nicht nur begrenzt, sondern schlichtweg lächerlich. Die Regionalbahn, die ich unlängst benutzte, fühlte sich bespielsweise bereits mit vier Fahrrädern überfordert. Alles, was mehr war, stand im Weg und barg außerdem die Gefahr, jederzeit umfallen zu können. Denn die früher üblichen Gurte, mit denen auf simpelste Weise Räder vertäut und standsicher gemacht werden konnten, existieren nicht mehr, nur noch metallene Ösen, an die man sein Rad anschließen kann - so man denn das Fahrrad besitzt, das unmittelbar an der Wand lehnt.
Die Schaffnerin war wenig erfreut, als sie das Radkonstrukt sah. "Dass die Leute aber auch ihre Räder nicht ordentlich hinstellen können...!", grummelte sie, obwohl die "Leute" allesamt mithören konnten. Und tatsächlich war es weniger die Schuld der "Leute", sondern vorrangig die der "anderen Leute", nämlich jener, die beschlossen hatten, dass sich die besten Sitzplätze dort befänden, wo für Fahrräder Platz gewesen wäre. So verhinderte beispielsweise eine äußerst beleibte Frau durch ihre Sitzhockerei, dass ich mein Rad optimal deponieren konnte - und ließ sich auch nicht davon stören, dass nur wenige Millimeter neben ihrem Leib zahlreiche Gummi- und Metallverflechtungen aufragten.
Ich sagte nichts, denn ich hielt sie nicht für dumm genug, ihre Albernheit nicht zu bemerken, ignorierte die Schaffnerin und setzte mich so, dass ich mein Rad im Blick hatte und jederzeit aufspringen konnte, um es am Umfallen zu hindern, wieder aufzuheben oder beiseite zu schaffen. Mir gegenüber saß ein Polizist, und ich war erstaunt, dass ich diesmal nicht das übliche Schuldgefühl verspürte, das mich sonst befällt, wenn ich der Ordnungsmacht gegenüberstehe. Ich habe nichts getan, und doch reicht die Anwesenheit eines Polizisten normalerweise aus, um mich zu fragen, ob ich nicht doch irgendwelche Übel verbrochen hatte.
Dieses Exemplar jedoch war vollkommen sympathisch. Er besaß weder den Klischeeschnauzbart noch den Klischeebierbauch, sondern ein freundliches und offenes Gesicht und eine häßliche Uniform. Die Idee, dass senfgelb auch nur ansatzweise sympathisch wirken könnte, erwies sich umso absurder, je länger ich auf das Hemd des Polizisten starrte. Die ganze Zeit über konnte ich mich des Gefühls nicht erwehren, mich in der Rückblende eines Films zu befinden, in der ausschließlich ausgeblichene Farben existierten. Und außerdem: Was sollte diese alberne Doppelnaht auf der Hemdhinterseite? Hatte sie eine Funktion? So wie die Hemdtasche, in der praktischerweise ein winziges, abgetrenntes Fach für Kugelschreiber existierte?
Ich besitze nur wenig Modekenntnis, doch konnte den Anblick des Hemdes kaum ertragen. Es war, als wäre ich in eine fremde Zeit katapultiert worden. 'Die Ärmel sind zu lang.', dachte ich noch, bevor mein Blick sich in den Sternen auf der Polizistenschulter verfing. Drei Sterne, und ich hatte keine Ahnung, ob das viel war oder was sie bedeuteten. Noch während ich grübelte, bemerkte ich die Mütze. Der Polizist hatte sie die ganze Zeit in der Hand gehalten, doch nun, da er in Begriff war auszusteigen, setzte er sie auf. Ach herrje! Kein Wunder, dass ich, wenn ich Polizisten zeichnete, immer an den Mützen verzweifelte. Diesen Dingern fehlte jede Ästhetik. Mehr noch: Sie waren imstande, die Häßlichkeit des Hemdes zu überbieten!
Der Zug war vollbesetzt. Daher konnte ich durchaus die dicke Dame verstehen, die sich krampfhaft an ihren, von Fahrrädern eingekeilten Sitzplatz klammerte. Und dennoch: Hier und da fanden sich jene, die selbst bei voller Zugbesetzung beschließen, sich unbedingt über zwei Plätze querlegen zu müssen. Mit einer höflichen Nachfrage hätte sicherlich jeder, auch die Stehenden, ein Plätzchen ergattern können. Doch im Pulk sind Menschen doof, und so wunderte es mich auch nicht, dass ausgerechnet dann, als der Zug seine Maximalbefüllung erreicht hatte, jemand beschloss, einen Bekannten anzurufen.
"Ich sitze gerade im Zug.", war dann auch der inhaltsintensivste Satz des Telefonats, dessen diesseitiger Anteil von gefühlten dreihundert Personen vernommen werden konnte. 'Warum sucht man sich ausgerechnet den am dichtesten gepackten Ort aus, um private Informationen zu verkünden?, fragte ich mich, doch wurde rasch wieder abgelenkt. Zwei Sitzplätze weiter löste eine junge Frau großformatiges Sudoku, und interessiert beteiligte ich mich an ihren Bemühungen, die leeren Kästchen zu füllen. "Da muss 'ne 4 rein!", wollte ich hinüberrufen, doch schwieg und starrte aus dem Fenster.
'Wie schnell fahren wir eigentlich?', überlegte ich. Offensichtlich nicht schnell genug, denn eine winzige Spinne hatte keine Mühe, auch bei höheren Geschwindigkeiten an der Außenseite der Fensterscheibe zu kleben. 'Nicht schlecht.', dachte ich bewundernd und erschrak, als es plötzlich schepperte. Ein Fahrrad war umgefallen - ausgerechnet das der lautstark Telefonierenden.
'Ich mag es, mit der Bahn zu fahren.', dachte ich und grinste.
Und ich mag es, mein Fahrrad mitzunehmen. Insbesondere bei Kurzstrecken und insbesondere in Sachsen-Anhalt, wo die Fahrradmitnahme in Regionalzügen kostenfrei ist, bietet es sich an, das eigene Rad als Begleitung zu erwählen, um im Stadtverkehr nicht zusätzlich für öffentliche Verkehrsmittel zahlen zu müssen und zugleich äußerst flexibel zu sein. Unglücklicherweise bin ich selten der einzige, der diesen Mobiltätsvorteil nutzt und muss häufig sehen, wie ich mein Fahrrad verstaue, ohne gleichzeitig den gesamten Gang zu blockieren.
Denn obwohl die Bahn freundlicherweise besondere Zugteile für Radreisende reserviert, ist die Anzahl dort positionierbarer Fahrräder nicht nur begrenzt, sondern schlichtweg lächerlich. Die Regionalbahn, die ich unlängst benutzte, fühlte sich bespielsweise bereits mit vier Fahrrädern überfordert. Alles, was mehr war, stand im Weg und barg außerdem die Gefahr, jederzeit umfallen zu können. Denn die früher üblichen Gurte, mit denen auf simpelste Weise Räder vertäut und standsicher gemacht werden konnten, existieren nicht mehr, nur noch metallene Ösen, an die man sein Rad anschließen kann - so man denn das Fahrrad besitzt, das unmittelbar an der Wand lehnt.
Die Schaffnerin war wenig erfreut, als sie das Radkonstrukt sah. "Dass die Leute aber auch ihre Räder nicht ordentlich hinstellen können...!", grummelte sie, obwohl die "Leute" allesamt mithören konnten. Und tatsächlich war es weniger die Schuld der "Leute", sondern vorrangig die der "anderen Leute", nämlich jener, die beschlossen hatten, dass sich die besten Sitzplätze dort befänden, wo für Fahrräder Platz gewesen wäre. So verhinderte beispielsweise eine äußerst beleibte Frau durch ihre Sitzhockerei, dass ich mein Rad optimal deponieren konnte - und ließ sich auch nicht davon stören, dass nur wenige Millimeter neben ihrem Leib zahlreiche Gummi- und Metallverflechtungen aufragten.
Ich sagte nichts, denn ich hielt sie nicht für dumm genug, ihre Albernheit nicht zu bemerken, ignorierte die Schaffnerin und setzte mich so, dass ich mein Rad im Blick hatte und jederzeit aufspringen konnte, um es am Umfallen zu hindern, wieder aufzuheben oder beiseite zu schaffen. Mir gegenüber saß ein Polizist, und ich war erstaunt, dass ich diesmal nicht das übliche Schuldgefühl verspürte, das mich sonst befällt, wenn ich der Ordnungsmacht gegenüberstehe. Ich habe nichts getan, und doch reicht die Anwesenheit eines Polizisten normalerweise aus, um mich zu fragen, ob ich nicht doch irgendwelche Übel verbrochen hatte.
Dieses Exemplar jedoch war vollkommen sympathisch. Er besaß weder den Klischeeschnauzbart noch den Klischeebierbauch, sondern ein freundliches und offenes Gesicht und eine häßliche Uniform. Die Idee, dass senfgelb auch nur ansatzweise sympathisch wirken könnte, erwies sich umso absurder, je länger ich auf das Hemd des Polizisten starrte. Die ganze Zeit über konnte ich mich des Gefühls nicht erwehren, mich in der Rückblende eines Films zu befinden, in der ausschließlich ausgeblichene Farben existierten. Und außerdem: Was sollte diese alberne Doppelnaht auf der Hemdhinterseite? Hatte sie eine Funktion? So wie die Hemdtasche, in der praktischerweise ein winziges, abgetrenntes Fach für Kugelschreiber existierte?
Ich besitze nur wenig Modekenntnis, doch konnte den Anblick des Hemdes kaum ertragen. Es war, als wäre ich in eine fremde Zeit katapultiert worden. 'Die Ärmel sind zu lang.', dachte ich noch, bevor mein Blick sich in den Sternen auf der Polizistenschulter verfing. Drei Sterne, und ich hatte keine Ahnung, ob das viel war oder was sie bedeuteten. Noch während ich grübelte, bemerkte ich die Mütze. Der Polizist hatte sie die ganze Zeit in der Hand gehalten, doch nun, da er in Begriff war auszusteigen, setzte er sie auf. Ach herrje! Kein Wunder, dass ich, wenn ich Polizisten zeichnete, immer an den Mützen verzweifelte. Diesen Dingern fehlte jede Ästhetik. Mehr noch: Sie waren imstande, die Häßlichkeit des Hemdes zu überbieten!
Der Zug war vollbesetzt. Daher konnte ich durchaus die dicke Dame verstehen, die sich krampfhaft an ihren, von Fahrrädern eingekeilten Sitzplatz klammerte. Und dennoch: Hier und da fanden sich jene, die selbst bei voller Zugbesetzung beschließen, sich unbedingt über zwei Plätze querlegen zu müssen. Mit einer höflichen Nachfrage hätte sicherlich jeder, auch die Stehenden, ein Plätzchen ergattern können. Doch im Pulk sind Menschen doof, und so wunderte es mich auch nicht, dass ausgerechnet dann, als der Zug seine Maximalbefüllung erreicht hatte, jemand beschloss, einen Bekannten anzurufen.
"Ich sitze gerade im Zug.", war dann auch der inhaltsintensivste Satz des Telefonats, dessen diesseitiger Anteil von gefühlten dreihundert Personen vernommen werden konnte. 'Warum sucht man sich ausgerechnet den am dichtesten gepackten Ort aus, um private Informationen zu verkünden?, fragte ich mich, doch wurde rasch wieder abgelenkt. Zwei Sitzplätze weiter löste eine junge Frau großformatiges Sudoku, und interessiert beteiligte ich mich an ihren Bemühungen, die leeren Kästchen zu füllen. "Da muss 'ne 4 rein!", wollte ich hinüberrufen, doch schwieg und starrte aus dem Fenster.
'Wie schnell fahren wir eigentlich?', überlegte ich. Offensichtlich nicht schnell genug, denn eine winzige Spinne hatte keine Mühe, auch bei höheren Geschwindigkeiten an der Außenseite der Fensterscheibe zu kleben. 'Nicht schlecht.', dachte ich bewundernd und erschrak, als es plötzlich schepperte. Ein Fahrrad war umgefallen - ausgerechnet das der lautstark Telefonierenden.
'Ich mag es, mit der Bahn zu fahren.', dachte ich und grinste.
morast - 9. Jul, 17:20 - Rubrik: Bahnbegegnungen
0 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks
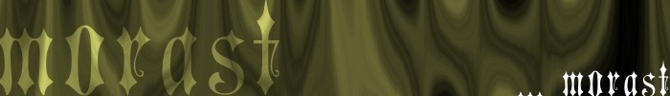



Trackback URL:
https://morast.twoday-test.net/stories/5048839/modTrackback