MiSt: Der Fernsehturm
Die Serie "MiSt - Morast in Stuttgart", die ich mit diesem Artikel kreiiere, zu der ich aber spontan auch ältere, passende hinzufügen werde, soll die Sehenswürdigkeiten Stuttgarts beleuchten - natürlich aus Morastscher Perspektive, also mit ausreichend Gesülze und anstrengender Faktenarmut. Es ist zu erwarten, dass noch weitere Texte folgen werden, die unter anderem Stuttgarts Nachtleben ... äh ... beleuchten.
Und so.
 Gegen Mittag riss mich das schlechte Gewissen aus dem Bett, eigentlich Stuttgart und seine Sehenswürdigkeiten besuchen und nicht den sonnenwetterwarmen Tag mit Unnötigkeiten vergammeln zu wollen. Doch als ich um vier noch immer zu Hause verweilte, zwar mit gefülltem Bauch, gesäubertem Geschirr und Körper, aber dennoch zu Hause, erdachte ich spontan das heutige Ausflugsziel: Der Stuttgarter Fernsehturm.
Gegen Mittag riss mich das schlechte Gewissen aus dem Bett, eigentlich Stuttgart und seine Sehenswürdigkeiten besuchen und nicht den sonnenwetterwarmen Tag mit Unnötigkeiten vergammeln zu wollen. Doch als ich um vier noch immer zu Hause verweilte, zwar mit gefülltem Bauch, gesäubertem Geschirr und Körper, aber dennoch zu Hause, erdachte ich spontan das heutige Ausflugsziel: Der Stuttgarter Fernsehturm.
Nicht viel mehr als eine halbe Stunde, behaupteten die öffentlichen Verkehrsmittel, würden sie brauchen, um mich zum 1956 eröffneten ersten Fernsehturm der Welt zu bringen. Ich glaubte ihnen, packte Fotoapparat und Geld, Zeichenutensiliar und einen Apfel ein, und vertraute mich zunächst einer S-, später einer U-Bahn an. Der Unterschied war offensichtlich: Die S-Bahn fuhr ausschließlich unterirdisch, die U-Bahn hingegen zumeist an der Erdoberfläche.
Es irrten absonderlichste Gestalten durch die Gegend: Eine hagere Frau mit Bartschatten, die vermutlich nicht feminin geboren war; ein Mann mit Picknickkorb, der an jeder Haltstelle ein Stück durch die S-Bahn schlurfte und dann irgendwo plötzlich, kurz bevor sich die Türen schlossen, träge ausstieg; ein Türke mit blond gefärbtem Haar und einem angefangenen Becher Ayran in der Hand, den er jedoch während der gesamten Fahrt ignorierte; verdreckte Mountainbiker, die offensichtlich diverse Strecken befahren hatten, aber nicht bereit waren, zwei oder drei Haltestellenentfernungen innerhalb der Stadt zurückzulegen - und natürlich ich.
Als Ortsfremder, der kein solcher sein möchte, legte ich mir die Angewohnheit zu, stets zielbewusst aufzutreten, selbst wenn ich ahnungslos mit meiner Orientierungsfähigkeit hadere. Demzufolge versuche ich Richtungs- und andere Entscheidungen zumeist schon zu treffen, bevor es an der Zeit wäre, dies zu tun. Eine Taktik, die sich bewährte, denn als ich an der Haltestelle Ruhbank Fernsehturm ausstieg, wandte ich mich entschlossen nach links, also irgendwohin, mit der Gewissheit, dass ein Fernsehturm sich freundlicherweise leicht entdecken lässt.
Und tatsächlich: Da war er, betonhellgrau aus Bäumen hervorragend, wenig imposant, wenig ästhetisch, aber immerhin vorhanden und schwerlich verfehlbar. Der Turm war umkränzt von Wald, und offensichtlich führten mehrere Wege durch ihn hindurch zur dem Bauwerk, das heute trotz seinem Namen nur noch Radiosignale versendet. Obwohl der Architekt angeblich dergleichen geplant hatte, käme niemand ersntlich auf den Gedanken, in dem Turm eine Art Betonbaum zu sehen, dem umgebenen Grün entwachsen.
 Der Turm enttäuschte mich bereits, bevor ich ihn überhaupt betreten hatte. Da er sich auf dem Hohen Bopser, also einem Bergchen befindet, hatte ich erwartet, ein paar Kilometer gen Himmel wandern zu müssen, doch die Strecke zwischen Haltestelle und Eingang war nicht nur kurz, sondern auch frei von Steigungen. Und obwohl es einen jährlichen Treppenlauf gibt, war mir der Zugang zu den 762 Stufen verwehrt. Statt dessen hatte ich fünf Euro Eintritt zu zahlen, um einen Aufzug zu benutzen, der erstaunlicherweise zwei Jahre vor Turmöffnung erbaut worden war und seichte Popmusik an mein Ohr dringen ließ.
Der Turm enttäuschte mich bereits, bevor ich ihn überhaupt betreten hatte. Da er sich auf dem Hohen Bopser, also einem Bergchen befindet, hatte ich erwartet, ein paar Kilometer gen Himmel wandern zu müssen, doch die Strecke zwischen Haltestelle und Eingang war nicht nur kurz, sondern auch frei von Steigungen. Und obwohl es einen jährlichen Treppenlauf gibt, war mir der Zugang zu den 762 Stufen verwehrt. Statt dessen hatte ich fünf Euro Eintritt zu zahlen, um einen Aufzug zu benutzen, der erstaunlicherweise zwei Jahre vor Turmöffnung erbaut worden war und seichte Popmusik an mein Ohr dringen ließ.
Drei Personalitäten kümmerten sich um alles Aufzugige. Nach der Begegnung mit dem Kartenverkäufer lief man drei Viertel eines Kreises um den Aufzug herum, um an einer Tür zu landen, die - natürlich - verschlossen war und erst durch eine Türöffnerin zum rechten Zeitpunkt freigegeben werden würde.
Ich war nicht der einzige Wartende. Ein weißbärtiger Vater erklärte seinem geistig behinderten Sohn geduldig und mit sympathischen Lachfalten um die Augen, was sie gerade zu tun beabsichtigten, während der Sohn immer wieder von Äpfeln berichtete. Liebevolle Eltern begeistern mich stets, und so kam es, dass meine Enttäuschung, die ohnehin nie immens gewesen war, sich verflüchtigte.
Im Fahrstuhl war es dann Person 3, die uns nach oben geleitete. Angeblich brauchte das Gefährt 36 Sekunden, um 150 Meter zu überwinden, doch anstatt dies verifizieren zu wollen, erfreute ich mich an der Digitalanzeige, die mir meine derzeitige Höhe mitteilte.
Trotz aller Erwartbarkeit hatte ich nicht damit gerechnet: Auf der Aussichtsplattform war es windig und dementsprechend kühl. Ich dankte meiner Jacke, obgleich sie unzureichend war, und starrte auf Stuttgart hinab.
Die Sonne schien, und ich freute mich darüber, ausgerechnet den heutigen Tag ausgewählt zu haben. Meine Kenntnis über Stuttgart liegt zwar in Nullnähe, und so war ich nicht fähig, irgendein Gebäude zu erkennen, doch das störte mich nicht. Denn gerade als ich über den Sonnenstand die Himmelrichtungen sortiert hatte, entdeckte ich auf der zweiten, der oberen Aussichtsplattform Erläuterungen zuhauf. Denn die Plattform wurde nicht nur von Geländer, sondern auch vorn einem kupfernen Kunstwerk umkränzt, das sowohl Nah- als auch auch Fernziele und Himmelsrichtung entsprechend der jeweiligen Blickrichtung bezifferte.
Und so hatte ich natürlich auch keine Probleme, meinen Wohn- und Arbeitsort zu entdecken - zunächst nur auf der kupfernen Karte, später doch glaubte ich auch in der Ferne bekannte Gebäude zu erkennen und beschloss einfach, dass meine Vermutungen wahr seien.
Nach einer Weile erschöpfte sich mein Interesse an Aussicht, und ich schlüpfte rasch in den gerade abfahren wollenden Fahrstuhl. Person 3, Popmusik, ignorierter Souvenirladen, Auf Wiedersehen.
Im Wald fand ich ein balzendes Vogelpärchen, das sich immer wieder meinem Fotoapparat entzog. Derart aufgeheitert begab ich mich zurück zur Haltestelle und beschloss, die zeitaufwändigere Fahrt mit der U15 der U7 vorzuziehen. Ich schaffte es nicht nur, gleichzeitig zu lesen, aus dem Fenster schauen und Stuttgart zu betrachten, sondern auch noch eine Straße wiederzuerkennen, in der ich mich bei meinem zweiten Besuch der baden-württembergischen Landeshauptstadt mehrfach verfahren hatte.
Schmunzelnd stieg ich am Schlossplatz aus, betrachtete eine zerrupft aussehende Taube, kaufte mir ein Schokoeis und genoss ein paar Sonnenstrahlen, bevor ich endgültig heimfuhr.
Und so.
 Gegen Mittag riss mich das schlechte Gewissen aus dem Bett, eigentlich Stuttgart und seine Sehenswürdigkeiten besuchen und nicht den sonnenwetterwarmen Tag mit Unnötigkeiten vergammeln zu wollen. Doch als ich um vier noch immer zu Hause verweilte, zwar mit gefülltem Bauch, gesäubertem Geschirr und Körper, aber dennoch zu Hause, erdachte ich spontan das heutige Ausflugsziel: Der Stuttgarter Fernsehturm.
Gegen Mittag riss mich das schlechte Gewissen aus dem Bett, eigentlich Stuttgart und seine Sehenswürdigkeiten besuchen und nicht den sonnenwetterwarmen Tag mit Unnötigkeiten vergammeln zu wollen. Doch als ich um vier noch immer zu Hause verweilte, zwar mit gefülltem Bauch, gesäubertem Geschirr und Körper, aber dennoch zu Hause, erdachte ich spontan das heutige Ausflugsziel: Der Stuttgarter Fernsehturm.Nicht viel mehr als eine halbe Stunde, behaupteten die öffentlichen Verkehrsmittel, würden sie brauchen, um mich zum 1956 eröffneten ersten Fernsehturm der Welt zu bringen. Ich glaubte ihnen, packte Fotoapparat und Geld, Zeichenutensiliar und einen Apfel ein, und vertraute mich zunächst einer S-, später einer U-Bahn an. Der Unterschied war offensichtlich: Die S-Bahn fuhr ausschließlich unterirdisch, die U-Bahn hingegen zumeist an der Erdoberfläche.
Es irrten absonderlichste Gestalten durch die Gegend: Eine hagere Frau mit Bartschatten, die vermutlich nicht feminin geboren war; ein Mann mit Picknickkorb, der an jeder Haltstelle ein Stück durch die S-Bahn schlurfte und dann irgendwo plötzlich, kurz bevor sich die Türen schlossen, träge ausstieg; ein Türke mit blond gefärbtem Haar und einem angefangenen Becher Ayran in der Hand, den er jedoch während der gesamten Fahrt ignorierte; verdreckte Mountainbiker, die offensichtlich diverse Strecken befahren hatten, aber nicht bereit waren, zwei oder drei Haltestellenentfernungen innerhalb der Stadt zurückzulegen - und natürlich ich.
Als Ortsfremder, der kein solcher sein möchte, legte ich mir die Angewohnheit zu, stets zielbewusst aufzutreten, selbst wenn ich ahnungslos mit meiner Orientierungsfähigkeit hadere. Demzufolge versuche ich Richtungs- und andere Entscheidungen zumeist schon zu treffen, bevor es an der Zeit wäre, dies zu tun. Eine Taktik, die sich bewährte, denn als ich an der Haltestelle Ruhbank Fernsehturm ausstieg, wandte ich mich entschlossen nach links, also irgendwohin, mit der Gewissheit, dass ein Fernsehturm sich freundlicherweise leicht entdecken lässt.
Und tatsächlich: Da war er, betonhellgrau aus Bäumen hervorragend, wenig imposant, wenig ästhetisch, aber immerhin vorhanden und schwerlich verfehlbar. Der Turm war umkränzt von Wald, und offensichtlich führten mehrere Wege durch ihn hindurch zur dem Bauwerk, das heute trotz seinem Namen nur noch Radiosignale versendet. Obwohl der Architekt angeblich dergleichen geplant hatte, käme niemand ersntlich auf den Gedanken, in dem Turm eine Art Betonbaum zu sehen, dem umgebenen Grün entwachsen.
 Der Turm enttäuschte mich bereits, bevor ich ihn überhaupt betreten hatte. Da er sich auf dem Hohen Bopser, also einem Bergchen befindet, hatte ich erwartet, ein paar Kilometer gen Himmel wandern zu müssen, doch die Strecke zwischen Haltestelle und Eingang war nicht nur kurz, sondern auch frei von Steigungen. Und obwohl es einen jährlichen Treppenlauf gibt, war mir der Zugang zu den 762 Stufen verwehrt. Statt dessen hatte ich fünf Euro Eintritt zu zahlen, um einen Aufzug zu benutzen, der erstaunlicherweise zwei Jahre vor Turmöffnung erbaut worden war und seichte Popmusik an mein Ohr dringen ließ.
Der Turm enttäuschte mich bereits, bevor ich ihn überhaupt betreten hatte. Da er sich auf dem Hohen Bopser, also einem Bergchen befindet, hatte ich erwartet, ein paar Kilometer gen Himmel wandern zu müssen, doch die Strecke zwischen Haltestelle und Eingang war nicht nur kurz, sondern auch frei von Steigungen. Und obwohl es einen jährlichen Treppenlauf gibt, war mir der Zugang zu den 762 Stufen verwehrt. Statt dessen hatte ich fünf Euro Eintritt zu zahlen, um einen Aufzug zu benutzen, der erstaunlicherweise zwei Jahre vor Turmöffnung erbaut worden war und seichte Popmusik an mein Ohr dringen ließ.Drei Personalitäten kümmerten sich um alles Aufzugige. Nach der Begegnung mit dem Kartenverkäufer lief man drei Viertel eines Kreises um den Aufzug herum, um an einer Tür zu landen, die - natürlich - verschlossen war und erst durch eine Türöffnerin zum rechten Zeitpunkt freigegeben werden würde.
Ich war nicht der einzige Wartende. Ein weißbärtiger Vater erklärte seinem geistig behinderten Sohn geduldig und mit sympathischen Lachfalten um die Augen, was sie gerade zu tun beabsichtigten, während der Sohn immer wieder von Äpfeln berichtete. Liebevolle Eltern begeistern mich stets, und so kam es, dass meine Enttäuschung, die ohnehin nie immens gewesen war, sich verflüchtigte.
Im Fahrstuhl war es dann Person 3, die uns nach oben geleitete. Angeblich brauchte das Gefährt 36 Sekunden, um 150 Meter zu überwinden, doch anstatt dies verifizieren zu wollen, erfreute ich mich an der Digitalanzeige, die mir meine derzeitige Höhe mitteilte.
Trotz aller Erwartbarkeit hatte ich nicht damit gerechnet: Auf der Aussichtsplattform war es windig und dementsprechend kühl. Ich dankte meiner Jacke, obgleich sie unzureichend war, und starrte auf Stuttgart hinab.
Die Sonne schien, und ich freute mich darüber, ausgerechnet den heutigen Tag ausgewählt zu haben. Meine Kenntnis über Stuttgart liegt zwar in Nullnähe, und so war ich nicht fähig, irgendein Gebäude zu erkennen, doch das störte mich nicht. Denn gerade als ich über den Sonnenstand die Himmelrichtungen sortiert hatte, entdeckte ich auf der zweiten, der oberen Aussichtsplattform Erläuterungen zuhauf. Denn die Plattform wurde nicht nur von Geländer, sondern auch vorn einem kupfernen Kunstwerk umkränzt, das sowohl Nah- als auch auch Fernziele und Himmelsrichtung entsprechend der jeweiligen Blickrichtung bezifferte.
Und so hatte ich natürlich auch keine Probleme, meinen Wohn- und Arbeitsort zu entdecken - zunächst nur auf der kupfernen Karte, später doch glaubte ich auch in der Ferne bekannte Gebäude zu erkennen und beschloss einfach, dass meine Vermutungen wahr seien.
Nach einer Weile erschöpfte sich mein Interesse an Aussicht, und ich schlüpfte rasch in den gerade abfahren wollenden Fahrstuhl. Person 3, Popmusik, ignorierter Souvenirladen, Auf Wiedersehen.
Im Wald fand ich ein balzendes Vogelpärchen, das sich immer wieder meinem Fotoapparat entzog. Derart aufgeheitert begab ich mich zurück zur Haltestelle und beschloss, die zeitaufwändigere Fahrt mit der U15 der U7 vorzuziehen. Ich schaffte es nicht nur, gleichzeitig zu lesen, aus dem Fenster schauen und Stuttgart zu betrachten, sondern auch noch eine Straße wiederzuerkennen, in der ich mich bei meinem zweiten Besuch der baden-württembergischen Landeshauptstadt mehrfach verfahren hatte.
Schmunzelnd stieg ich am Schlossplatz aus, betrachtete eine zerrupft aussehende Taube, kaufte mir ein Schokoeis und genoss ein paar Sonnenstrahlen, bevor ich endgültig heimfuhr.
0 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks
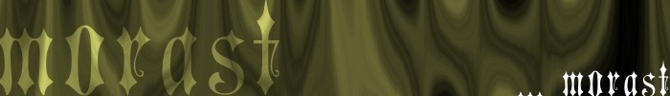
 Wenn ich Stuttgart als meinen derzeitigen Wohnort angebe, schaffe ich es, gleichzeitig zu lügen und die Wahrheit zu sagen. Denn tatsächlich wohne ich einem mit eigenem Markt und Einkaufzentrum ausgestatteten Vorort Stuttgarts, der vom Stadtkern getrennt ist, aber dennoch zur baden-württembergischen Landeshauptstadt gezählt wird. Zwischen mir, also dem Ort, an dem ich sitze und diesen Text tippe, und der Innenstadt, also beispielsweise dem Hauptbahnhof, liegen jedoch ein paar U- beziehungsweise S-Bahnminuten, die nicht nur mit Gleisen beziehungsweise Straßen gefüllt sind, sondern auch mit Wald.
Wenn ich Stuttgart als meinen derzeitigen Wohnort angebe, schaffe ich es, gleichzeitig zu lügen und die Wahrheit zu sagen. Denn tatsächlich wohne ich einem mit eigenem Markt und Einkaufzentrum ausgestatteten Vorort Stuttgarts, der vom Stadtkern getrennt ist, aber dennoch zur baden-württembergischen Landeshauptstadt gezählt wird. Zwischen mir, also dem Ort, an dem ich sitze und diesen Text tippe, und der Innenstadt, also beispielsweise dem Hauptbahnhof, liegen jedoch ein paar U- beziehungsweise S-Bahnminuten, die nicht nur mit Gleisen beziehungsweise Straßen gefüllt sind, sondern auch mit Wald.  Der schmale Pfad ging steil bergab. Ich grinste und wusste genau, dass mein Rad für solche Strecken eindeutig ungeeignet war. Der Boden war feucht, zu großen Teilen matschig, und wenn ich mit altmodischem Rücktritt bremste, schlug das Hinterrad aus. Es war steil genug, dass ich den Rücktritt irgendwann kontinuierlich betätigte, nur um die Geschwindigkeit annähernd beizubehalten. Alsbald musste ich auch die Vorderbremse einbeziehen, und ich war dankbar dafür, dass ich den umgestürzten Baum bereits längst gesehen hatte, bevor ich ihn erreichte, denn hätte er sich hinter einer der zahlreichen winzigen Kurven befunden, wäre ich vermutlich zusammen mit meinem Gefährt umgehend die Böschung hinunterstürzt.
Der schmale Pfad ging steil bergab. Ich grinste und wusste genau, dass mein Rad für solche Strecken eindeutig ungeeignet war. Der Boden war feucht, zu großen Teilen matschig, und wenn ich mit altmodischem Rücktritt bremste, schlug das Hinterrad aus. Es war steil genug, dass ich den Rücktritt irgendwann kontinuierlich betätigte, nur um die Geschwindigkeit annähernd beizubehalten. Alsbald musste ich auch die Vorderbremse einbeziehen, und ich war dankbar dafür, dass ich den umgestürzten Baum bereits längst gesehen hatte, bevor ich ihn erreichte, denn hätte er sich hinter einer der zahlreichen winzigen Kurven befunden, wäre ich vermutlich zusammen mit meinem Gefährt umgehend die Böschung hinunterstürzt. Der Stuttgarter Club Zentral hatte zu den sogenannten Metal Nights geladen und mich frisch Zugezogenen mit schwermetallischen Bands gelockt. Ich wehrte mich nicht, und erwarb eine Karte, die mir ermöglichen sollte, Agathodaimon, eine von mir seit ungefähr zehn Jahren gutgefundene Klangformation, live zu erleben, begleitet von Agrypnie, dem Projekt, das aus den nicht mehr existierenden, aber von mir noch immer hochgeschätzten Kapelle Nocte Obducta hervorging.
Der Stuttgarter Club Zentral hatte zu den sogenannten Metal Nights geladen und mich frisch Zugezogenen mit schwermetallischen Bands gelockt. Ich wehrte mich nicht, und erwarb eine Karte, die mir ermöglichen sollte, Agathodaimon, eine von mir seit ungefähr zehn Jahren gutgefundene Klangformation, live zu erleben, begleitet von Agrypnie, dem Projekt, das aus den nicht mehr existierenden, aber von mir noch immer hochgeschätzten Kapelle Nocte Obducta hervorging. 














