Die Begegnung
Als ich aus dem Zug stieg, stand er bereits auf dem Bahnsteig. Er starrte blind in die ankommende Menschenmenge, ohne mich zu entecken. Ich hatte ihn nicht erwartet, nicht so zeitig, nicht bereits heute, doch empfand keinerlei Überaschung.
Ich tippte ihm auf die Schulter, aber grüßte nicht, als er sich behende zu mir umdrehte. Wir kannten einander zu gut, um uns noch mit Höflichkeiten abgeben zu müssen.
Seine zusammengekniffenen Lippen formten ein höhnisches Lächeln. Auch er zeigte keine Spur von Überraschung.
'Ich hatte ihn nicht erkennen sollen.', dachte ich.
Sein Mantel war neu. Seine Schuhe ebenso. Mattschwarz reflektierten sie das fahle Licht der Bahnsteigslaternen.
'Ich hätte ihn übersehen und vergessen sollen.', dachte ich.
Der Zug fuhr ab. Sein Dröhnen tilgte jedes Wort. Doch wir redeten nicht, sahen uns nur an, abschätzend.
Wind umwirbelte uns, zerzauste sein Haar, fuhr mir kalt unter die Kleider.
"Es wäre besser gewesen, du hättest mich noch nicht entdeckt.", meinte er schließlich , als der Zug in der Ferne verschwunden und der Bahnsteig geleert war. Seine Stimme war nur schwacher Hauch, doch schwanger von Verachtung. Jedes einzelne Wort klang, als hätte er es in mein Gesicht gespuckt.
"Es wäre besser gewesen, du wärest in dem Glauben, entkommen, entflohen zu sein, in deine Wohung eingekehrt und hättest lächeln können."
"Besser für dich?", fragte ich, die Antwort bereits ahnend.
"Besser für uns."
Die Vergangenheit klebte mottenzerfressen zwischen uns, hing grauschwarz in seinen Augen. Wir kannten einander seit Ewigkeiten, begegneten uns zu häufig, um uns nicht verbunden zu fühlen. Und doch hatte sich niemals eine Freundschaft, noch nicht einmal Sympathie füreinander, entwickeln können. Längst glichen sich unsere Gedanken - und dennoch haßte ich ihn.
Wäre ich ihm nicht begegnet, hätte ich mich der Illusion hingeben könne, hier, in der Fremde, unerkannt und unbehelligt existieren zu können, alles Gestrige abgestreift zu haben.
Wäre ich ihm nicht begegnet, hätte Ruhe meine Seele finden und verhüllen können, trügerische Ruhe vielleicht, doch Selbstbetrug war stets ein willkommener Teil meiner Wirklichkeit gewesen.
Wäre ich ihm nicht begegnet, hätte ich glauben können, alles wäre gut, für ein paar Tage nur, doch immerhin, bis er schließlich aufgetaucht wäre, mit wallendem, neuem Mantel und dem altbekannten höhnischen Zug um den rechten Mundwinkel.
Die Begegnung mit ihm war unausweichlich. Er fand stets mich, ohne zu suchen. Er hüllte sich in neue Gewänder, änderte seine Frisur, seinen Stil - doch ihn zu erkennen, zu entdecken, fiel mir zu keiner Zeit schwer. Er lähmte mich, raubte mir Willen und Worte, brannte kalte Furcht in meine Gedanken.
Oft genug rannte ich, floh, suchte Neues, Fremdes, Fernes, hielt mich fest an Dingen, die Hoffnung schenkten. Ich lebte mich ein, wohin die Flucht mich trug, hielt inne, um Atem zu schöpfen - und ihm erneut zu begegnen. Er war überall, wartete bereits, wo ich nach neuen Wegen begehrte.
Oft genug versteckte er sich, tarnte sich ungeschickt, schlich heimlich durch die Grenzen meines Blickfelds. Und dann schlug er zu, mit doppelter, zehnfacher Intensität, baute sich vor mir auf und legte einen Ring aus Schatten und Angst um meinen Leib. Eingeschnürt spürte ich, wie er seinen kalten Atem in mein Antlitz lachte...
"Was willst du?", fragte ich.
"Das Gleiche wie immer."
Ich schaute fragend, stellte mich dumm.
Er seufzte genervt. Das gleiche Spiel wie immer. Wie immer hatte er gehofft, das Ritual umgehen zu können, den drohenden Singsang, den er bei jeder einzelnen Begegnung anstimmte, schweigen zu lassen.
"Gib mir dein Licht!", mahnte er, alte Worte nutzend, "Reiche mir einen Teil deines Herzens! Schenke mir einen Hauch deiner selbst!
Und du wirst frei sein. Frei für den Moment. Frei für kommende Zeiten. Frei, bis zu meiner Wiederkehr".
Und er wird wiederkehren. Niemals reichte aus, was ich ihm gab, niemals sättigte es ihn. Er wird wiederkehren und das Ewiggleiche wiederholen, seine Kälte in meine Ohren träufeln, wie er es immer tat. Bis ich ihn füttere. Mit mir selbst füttere.
"Nein."
Meine Stimme brach. Er sah mich an. Fragend. Überrascht. Kannte das Ritual. Das ich verletzte.
"Nein.", wiederhole ich, lauter diesmal. Ruhig nach außen hin. Doch zitternd im Inneren.
Jede Begegung mit ihm raubte mir einen Teil meiner Selbst, raubte mir Licht, raubte mir Kraft. Irgendwann schießlich würde ich erlöschen, verwelken, ausgelaugt auf Erden wandeln, mich seinen Befehlen beugend, seine Wege begehend. Willenlos. Stumm. Ohne Leben.
Doch noch lebte ich. Kaum brachte ich die Kraft auf, ihm zu widersprechen, das Ritual zu brechen, ihm das Gewünschte, Geforderte, zu verweigern. Vielleicht war die heutige Begenung die letzte ihrer Art, die letzte vor dem Unterschreiten der Schwelle, die letzte vor dem endgültigen Verlust meiner selbst.
"Nein.", sagte ich ein drittes Mal. Meine Stimme hatte wieder an Stärke verloren, doch er hatte mich längst gehört.
"Was willst du tun?", fragte er. Das höhnische Grinsen, das kurz geflackert hatte, strahlte schon wieder in altem Glanz.
"Willst du fliehen? Fliehen, wie tausend vergebliche Male zuvor?"
Ich schüttelte den Kopf, zu Worten nicht mehr fähig.
"Willst du dich selbst vernichten, dir dein lächerliches Leben nehmen, um nicht nur mir, sondern allem zu entkommen?"
Er lachte.
"Willst Schutz suchen, bei Freunde, Liebenden, Sorgenden, dort, wo ich dich dennoch fassen, ergreifen, kann?"
"Oder willst du dich stellen, gegen mich kämpfen?"
Er lachte erneut, lauter diesmal.
"Lächerlich", schnaubte er und wandte sich ab.
"Ich stelle mich.", flüsterte ich ihm hinterher. Er drehte sich nicht um.
"Ich stelle mich.", wiederholte ich.
Ich wußte, daß er grinste, verächtlich, als wäre ich keines Blickes, keiner Mühen wert.
"Du weißt, daß du mich nicht vernichten kannst?", fragte er, ohne mich anzusehen.
"Du weißt, daß ich nicht sterben kann, nicht, solange du lebst? Du weißt, daß ich immer wiederkehren werden, daß du nicht nur ein einziges Mal kämpfen, nicht nur eine Schlacht zu schlagen brauchst, sondern zahllose, wieder und wieder, täglich, stündlich?
Ich habe tausend Gesichter, tausend Namen, finde dich immer, egal wo du bist. Und jedesmal wirst dich stellen müssen, jedesmal kämpfen. Und niemals wirst du gewinnen."
Sein Mantel rauschte bedrohlich, als er sich schwungvoll zu mir umdrehte. Er schien gewachsen zu sein. Schatten tanzten finster auf seinem kantigen Gesicht. Sein Grinsen war verschwunden, hinterließ eine Fratze der Bosheit.
"Gib mir dein Licht!", dröhnte er, "Gib mir dein Licht, und ich werde vorerst schweigen. Verweigere dich, und du wirst jedes Glück aus deinem Dasein tilgen!"
Ich hob den Kopf. Zitterte. Jeder Atemzug fiel mir schwer. Doch ich war mir sicher. Zum ersten Mal seit Jahren.
"Ich stelle mich.", rief ich zu dritten Mal, versuchte, meine letzten Kräfte in diese Worte zu legen. Alles in mir schrie nach Flucht, wollte weichen, nicht länger seinem Anblick, seiner Gegenwart ausgesetzt sein. Doch ich blieb.
Er musterte mich. Neugierig. Wütend. Belustigt.
"Na gut.", sagte er und ging.
Ich sah ihm nach. Der Wind ließ seinen Mantel tanzen. Gelassenen Schrittens überquerte er die Gleise.Eine Zigarette glomm wie ein drittes Auge zwischen seinen Mundwinkeln, als er hinter parkenden Autos verschwand.
Ich blieb stehen, bis meine Knie aufgehört hatten zu zittern. Reisende befüllten allmählich den Bahnsteig, beachteten mich nicht. Als ich das Bahnhofsgebäude hinter mir gelassen hatte, atmete ich auf.
'Es war zu einfach', dachte ich und wußte, daß er irgendwo stand, mich beobachtete und höhnisch grinste. Wir kannten einander, waren untrennbar verbunden. Er war ich, ein Teil von mir. Er war meine Angst. Er war meine Furcht.
'Die nächste Begegnung mit ihm wird die schwerste', überlegte ich und lächelte trotzdem.
'So war es immer.'
Ich tippte ihm auf die Schulter, aber grüßte nicht, als er sich behende zu mir umdrehte. Wir kannten einander zu gut, um uns noch mit Höflichkeiten abgeben zu müssen.
Seine zusammengekniffenen Lippen formten ein höhnisches Lächeln. Auch er zeigte keine Spur von Überraschung.
'Ich hatte ihn nicht erkennen sollen.', dachte ich.
Sein Mantel war neu. Seine Schuhe ebenso. Mattschwarz reflektierten sie das fahle Licht der Bahnsteigslaternen.
'Ich hätte ihn übersehen und vergessen sollen.', dachte ich.
Der Zug fuhr ab. Sein Dröhnen tilgte jedes Wort. Doch wir redeten nicht, sahen uns nur an, abschätzend.
Wind umwirbelte uns, zerzauste sein Haar, fuhr mir kalt unter die Kleider.
"Es wäre besser gewesen, du hättest mich noch nicht entdeckt.", meinte er schließlich , als der Zug in der Ferne verschwunden und der Bahnsteig geleert war. Seine Stimme war nur schwacher Hauch, doch schwanger von Verachtung. Jedes einzelne Wort klang, als hätte er es in mein Gesicht gespuckt.
"Es wäre besser gewesen, du wärest in dem Glauben, entkommen, entflohen zu sein, in deine Wohung eingekehrt und hättest lächeln können."
"Besser für dich?", fragte ich, die Antwort bereits ahnend.
"Besser für uns."
Die Vergangenheit klebte mottenzerfressen zwischen uns, hing grauschwarz in seinen Augen. Wir kannten einander seit Ewigkeiten, begegneten uns zu häufig, um uns nicht verbunden zu fühlen. Und doch hatte sich niemals eine Freundschaft, noch nicht einmal Sympathie füreinander, entwickeln können. Längst glichen sich unsere Gedanken - und dennoch haßte ich ihn.
Wäre ich ihm nicht begegnet, hätte ich mich der Illusion hingeben könne, hier, in der Fremde, unerkannt und unbehelligt existieren zu können, alles Gestrige abgestreift zu haben.
Wäre ich ihm nicht begegnet, hätte Ruhe meine Seele finden und verhüllen können, trügerische Ruhe vielleicht, doch Selbstbetrug war stets ein willkommener Teil meiner Wirklichkeit gewesen.
Wäre ich ihm nicht begegnet, hätte ich glauben können, alles wäre gut, für ein paar Tage nur, doch immerhin, bis er schließlich aufgetaucht wäre, mit wallendem, neuem Mantel und dem altbekannten höhnischen Zug um den rechten Mundwinkel.
Die Begegnung mit ihm war unausweichlich. Er fand stets mich, ohne zu suchen. Er hüllte sich in neue Gewänder, änderte seine Frisur, seinen Stil - doch ihn zu erkennen, zu entdecken, fiel mir zu keiner Zeit schwer. Er lähmte mich, raubte mir Willen und Worte, brannte kalte Furcht in meine Gedanken.
Oft genug rannte ich, floh, suchte Neues, Fremdes, Fernes, hielt mich fest an Dingen, die Hoffnung schenkten. Ich lebte mich ein, wohin die Flucht mich trug, hielt inne, um Atem zu schöpfen - und ihm erneut zu begegnen. Er war überall, wartete bereits, wo ich nach neuen Wegen begehrte.
Oft genug versteckte er sich, tarnte sich ungeschickt, schlich heimlich durch die Grenzen meines Blickfelds. Und dann schlug er zu, mit doppelter, zehnfacher Intensität, baute sich vor mir auf und legte einen Ring aus Schatten und Angst um meinen Leib. Eingeschnürt spürte ich, wie er seinen kalten Atem in mein Antlitz lachte...
"Was willst du?", fragte ich.
"Das Gleiche wie immer."
Ich schaute fragend, stellte mich dumm.
Er seufzte genervt. Das gleiche Spiel wie immer. Wie immer hatte er gehofft, das Ritual umgehen zu können, den drohenden Singsang, den er bei jeder einzelnen Begegnung anstimmte, schweigen zu lassen.
"Gib mir dein Licht!", mahnte er, alte Worte nutzend, "Reiche mir einen Teil deines Herzens! Schenke mir einen Hauch deiner selbst!
Und du wirst frei sein. Frei für den Moment. Frei für kommende Zeiten. Frei, bis zu meiner Wiederkehr".
Und er wird wiederkehren. Niemals reichte aus, was ich ihm gab, niemals sättigte es ihn. Er wird wiederkehren und das Ewiggleiche wiederholen, seine Kälte in meine Ohren träufeln, wie er es immer tat. Bis ich ihn füttere. Mit mir selbst füttere.
"Nein."
Meine Stimme brach. Er sah mich an. Fragend. Überrascht. Kannte das Ritual. Das ich verletzte.
"Nein.", wiederhole ich, lauter diesmal. Ruhig nach außen hin. Doch zitternd im Inneren.
Jede Begegung mit ihm raubte mir einen Teil meiner Selbst, raubte mir Licht, raubte mir Kraft. Irgendwann schießlich würde ich erlöschen, verwelken, ausgelaugt auf Erden wandeln, mich seinen Befehlen beugend, seine Wege begehend. Willenlos. Stumm. Ohne Leben.
Doch noch lebte ich. Kaum brachte ich die Kraft auf, ihm zu widersprechen, das Ritual zu brechen, ihm das Gewünschte, Geforderte, zu verweigern. Vielleicht war die heutige Begenung die letzte ihrer Art, die letzte vor dem Unterschreiten der Schwelle, die letzte vor dem endgültigen Verlust meiner selbst.
"Nein.", sagte ich ein drittes Mal. Meine Stimme hatte wieder an Stärke verloren, doch er hatte mich längst gehört.
"Was willst du tun?", fragte er. Das höhnische Grinsen, das kurz geflackert hatte, strahlte schon wieder in altem Glanz.
"Willst du fliehen? Fliehen, wie tausend vergebliche Male zuvor?"
Ich schüttelte den Kopf, zu Worten nicht mehr fähig.
"Willst du dich selbst vernichten, dir dein lächerliches Leben nehmen, um nicht nur mir, sondern allem zu entkommen?"
Er lachte.
"Willst Schutz suchen, bei Freunde, Liebenden, Sorgenden, dort, wo ich dich dennoch fassen, ergreifen, kann?"
"Oder willst du dich stellen, gegen mich kämpfen?"
Er lachte erneut, lauter diesmal.
"Lächerlich", schnaubte er und wandte sich ab.
"Ich stelle mich.", flüsterte ich ihm hinterher. Er drehte sich nicht um.
"Ich stelle mich.", wiederholte ich.
Ich wußte, daß er grinste, verächtlich, als wäre ich keines Blickes, keiner Mühen wert.
"Du weißt, daß du mich nicht vernichten kannst?", fragte er, ohne mich anzusehen.
"Du weißt, daß ich nicht sterben kann, nicht, solange du lebst? Du weißt, daß ich immer wiederkehren werden, daß du nicht nur ein einziges Mal kämpfen, nicht nur eine Schlacht zu schlagen brauchst, sondern zahllose, wieder und wieder, täglich, stündlich?
Ich habe tausend Gesichter, tausend Namen, finde dich immer, egal wo du bist. Und jedesmal wirst dich stellen müssen, jedesmal kämpfen. Und niemals wirst du gewinnen."
Sein Mantel rauschte bedrohlich, als er sich schwungvoll zu mir umdrehte. Er schien gewachsen zu sein. Schatten tanzten finster auf seinem kantigen Gesicht. Sein Grinsen war verschwunden, hinterließ eine Fratze der Bosheit.
"Gib mir dein Licht!", dröhnte er, "Gib mir dein Licht, und ich werde vorerst schweigen. Verweigere dich, und du wirst jedes Glück aus deinem Dasein tilgen!"
Ich hob den Kopf. Zitterte. Jeder Atemzug fiel mir schwer. Doch ich war mir sicher. Zum ersten Mal seit Jahren.
"Ich stelle mich.", rief ich zu dritten Mal, versuchte, meine letzten Kräfte in diese Worte zu legen. Alles in mir schrie nach Flucht, wollte weichen, nicht länger seinem Anblick, seiner Gegenwart ausgesetzt sein. Doch ich blieb.
Er musterte mich. Neugierig. Wütend. Belustigt.
"Na gut.", sagte er und ging.
Ich sah ihm nach. Der Wind ließ seinen Mantel tanzen. Gelassenen Schrittens überquerte er die Gleise.Eine Zigarette glomm wie ein drittes Auge zwischen seinen Mundwinkeln, als er hinter parkenden Autos verschwand.
Ich blieb stehen, bis meine Knie aufgehört hatten zu zittern. Reisende befüllten allmählich den Bahnsteig, beachteten mich nicht. Als ich das Bahnhofsgebäude hinter mir gelassen hatte, atmete ich auf.
'Es war zu einfach', dachte ich und wußte, daß er irgendwo stand, mich beobachtete und höhnisch grinste. Wir kannten einander, waren untrennbar verbunden. Er war ich, ein Teil von mir. Er war meine Angst. Er war meine Furcht.
'Die nächste Begegnung mit ihm wird die schwerste', überlegte ich und lächelte trotzdem.
'So war es immer.'
morast - 13. Feb, 13:39 - Rubrik: Wortwelten
0 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks
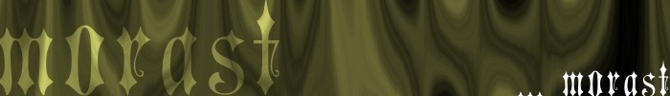



Trackback URL:
https://morast.twoday-test.net/stories/3315319/modTrackback